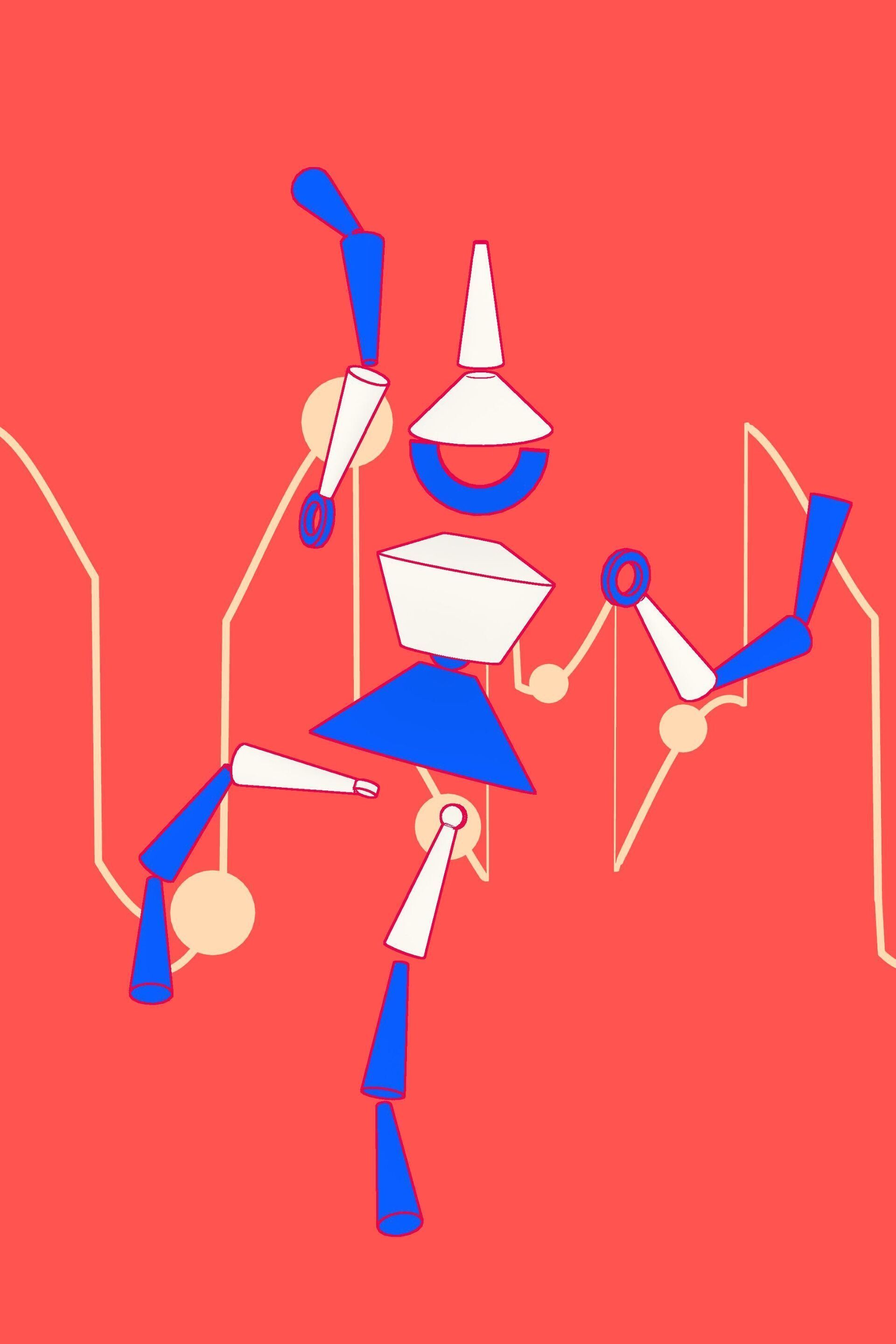Museum of the Future – 17 digitale Experimente
Wie zeigt man ein Objekt, das zu gross, zu fragil oder zu wertvoll ist, um es auszustellen? Eine Ausstellung im Museum für Gestaltung Zürich – kuratiert von Sophie Grossmann – geht dieser Frage nach. Bis zum 1. Februar 2026 zeigt sie anhand konkreter Experimente mit digitalen Mitteln und Künstlicher Intelligenz, wie Unsichtbares sichtbar gemacht werden kann. Zwischen Bewahren und Vermitteln sind 17 Szenarien entstanden, die Konventionen und Routinen des Ausstellens in Frage stellen.

Detail aus dem digitalen «Terapixel-Panorama», 2025 | Foto: Nina Farhumand
Die Schau trägt den Titel «Museum of the Future – 17 digitale Experimente». Die Projekte sind nicht als lineare Ausstellung, sondern als thematisch gegliederte Versuchsanordnung gedacht. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, mitzugestalten, zu hinterfragen und neue Formen der Begegnung mit Exponaten zu erproben. Der folgende Bericht führt durch die zentralen Themen und stellt alle 17 Stationen in ihrer Vielfalt und Zielsetzung vor.

Die Welt als Spinne erleben:In der multisensorischen VR-Installation «Spinne sein» (2025) simulieren Wind, Vibration und Sicht die Sinneswelt einer Vierfleck-Zartspinne auf nächtlicher Beutejagd.| Foto: Nina Farhumand
Digitale Spiegelbilder: KI als Interface
Den Auftakt macht «TRUST AI» von Bernd Lintermann und Florian Hertweck – eine medienkünstlerische Installation, die mit der Identität der Besuchenden spielt. Innerhalb weniger Sekunden erschafft die KI ein täuschend echtes, aber manipuliertes Abbild, das Rückfragen nach Wahrhaftigkeit, Kontrolle und Vertrauen provoziert.
«AI Decode» zeigt, wie künstliche Intelligenz dabei hilft, verschollene Texte zu entschlüsseln. Historische Schriftstücke – von Keilschriften bis Renaissance-Briefen – werden mithilfe von Machine Learning lesbar gemacht.
In «AI Imagine» trifft KI auf Designgeschichte: Ob vertrauter Alltagsgegenstand wie der Sparschäler oder stilbildender Klassiker wie die Chaiselongue – Algorithmen analysieren Form, Funktion und Stil und generieren daraus überraschende Neuinterpretationen. Die Resultate reichen von leicht veränderten Varianten bis zu surrealen Visionen – und zeigen, wie nah sich Analyse, Assoziation und Abstraktion in der KI-Welt kommen können.

Beim «Prompt Battle» in «AI Imagine» (2025) generiert die KI auf Zuruf überraschende Varianten ikonischer Objekte. | Foto: Nina Farhumand
Reproduktion, Rückgabe und Rekonstruktion
«Double Truth II» bringt sakrale Skulpturen aus Indien, dokumentiert durch Fotogrammetrie, als digitale 3D-Modelle ins Museum. Die Besucher*innen können sie frei betrachten und drehen – eine präzise und doch körperlose Nähe zu nicht transportierbaren Originalen.
«Benin: Reproduktionen» verhandelt die komplexen Fragen rund um koloniale Raubkunst. Anhand digitaler Repliken werden rechtliche, politische und ethische Debatten um Rückgabe sichtbar gemacht.
Die Station «Pavillon Le Corbusier: Rekonstruktionen» erlaubt den Vergleich zwischen dem gebauten Pavillon aus Glas und Stahl und einer digitalen Rekonstruktion des ursprünglich geplanten Betonbaus. Punktwolken-Scan, Film, Fotoessay und digitale Modelle machen den Entwurfsprozess nachvollziehbar.

In einer VR-Experience begehen Besucher*innen die digital rekonstruierte Betonvariante des Pavillon Le Corbusier. | Foto: Nina Farhumand
Natur digital inszeniert
«Raffinierte Geometrien: Insekten ganz gros» bringt zwölf einheimische Insektenarten in überlebensgrosser, digitaler Auflösung ins Museum. Die Modelle lassen sich drehen, zoomen und analysieren – ein ästhetisches und biologisches Erlebnis zugleich.
«Spinne sein» wechselt die Perspektive: In einer multisensorischen VR-Erfahrung erleben die Besuchenden die Welt mit den Sinnen einer Spinne. Das Projekt verknüpft Technologie, Verhaltensforschung und Design zu einem immersiven Perspektivwechsel.
Geschichte in Ultraauflösung
Mit 1,6 Billionen Pixeln ist das «Terapixel-Panorama» das aktuell grösste digitale Bild weltweit. Es zeigt die Schlacht bei Murten auf über eintausend Quadratmetern. Das digitale Remake ermöglicht es, kleinste Unterschiede in Malweise und Erzählung interaktiv zu entdecken. Begleitet wird das Werk von einer Klanglandschaft und räumlicher Inszenierung.

Das Panoramagemälde Schlacht bei Murten (1893/94) wurde digitalisiert und ist mit 1,6 Terapixeln das derzeit grösste digitale Bild der Welt. Detailaufnahme Terapixel Panorama, 2025 | Foto © Laboratory for Experimental Museo-logy, EPFL
Körper, Bühne und digitale Choreografie
«Triadic Triptych» interpretiert Oskar Schlemmers Triadisches Ballett mit KI neu: Ausgehend von Bewegungsdaten realer Tänzer*innen entstehen digitale Skulpturen und Choreografien, die Schlemmers Idee einer geometrisierten Körperkunst weiterdenken.
«Play in Abstraction – digitale Interaktonen mit Sophie Taeuber-Arp ist ein Beitrag von Studierenden der ZHdK, die das Marionetten-Ensemble aus König Hirsch (1918) neu inszenieren. Die originalen Figuren von Sophie Taeuber-Arp – darunter Dr. Komplex und Freudanalytikus – wurden als 3D-Scans digitalisiert und bilden die Grundlage für mehrere spielerische Experimente. In der Ausstellung begegnen sie schwebend als digitale Protagonist*innen. Interaktive Interfaces laden dazu ein, Farbe, Form und Bewegung der abstrahierten Figuren zu erforschen – und machen das komplexe Zusammenspiel von Gestaltung, Bewegung und digitaler Technik erlebbar.
«Die perfekte Form», ein computeranimierter Kurzfilm, setzt Motion-Capture-Technik ein, um eigene Figuren und Atmosphären im digitalen Raum zu gestalten.
«Das virtuelle Theater. Die Marionetten von Sophie Taeuber-Arp» geht noch einen Schritt weiter: Hier steuern die Besuchenden die digitalen Marionettenkörper selbst – mit dem ganzen Körper. Die Originalfiguren Sophie Taeuber-Arps bleiben unberührt, doch ihre virtuellen Zwillinge tanzen.
Interaktive Vermittlung und internationale Perspektiven
«Animating the Avant-Garde» übersetzt präzise Handbewegungen der Besuchenden in choreografierte Bewegungen der Marionetten. Die Multi-User-Oberfläche ermöglicht kollektives Spiel mit abstrakten Bewegungsformen.
In «Conversations with Puppets» sprechen drei digitalisierte Stockpuppen von Fred Schneckenburger – verbunden mit einem LLM – auf unterhaltsame Weise über Kunst, Gesellschaft und Menschliches. Archivaufnahmen wurden transkribiert und aktualisiert.
«Sammlung global» schliesst die Schau mit einem internationalen Blick: Designer:innen aus sechs Ländern (Brasilien, China, Indien, Japan, Südafrika, USA) haben auf Basis digitalisierter Sammlungsobjekte eigene Arbeiten entwickelt. Die Projekte verbinden lokale Ästhetiken mit globalen Fragen nach kulturellem Erbe.
Eindruck der Redaktion
Die Ausstellung ist dicht, technisch anspruchsvoll und offen zugleich. Sie macht deutlich, wie digitale Werkzeuge nicht nur Abbild oder Ersatz sein können, sondern selbst zu gestalterischen Mitteln werden. Besonders gelungen ist der Wechsel von interaktiven Interfaces zu stillen Reflexionsräumen, von historischen Referenzen zu spekulativen Zukunftsentwürfen. Was uns beim Rundgang besonders auffiel: Wie viel man selbst ausprobieren kann. Ob Marionetten steuern, Insekten vergrössern, mit KI prompten oder sich durch ein digitales Panorama zoomen – die Ausstellung setzt auf Einbindung der Besuchenden.
Museum für Gestaltung Zürich
Museum of the Future. 17 digitale Experimente
Ausstellung: 29. August 2025 bis 1. Februar 2026
Ort: Ausstellungsstrasse 60, Zürich
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10–17, Donnerstag 10–20 Uhr