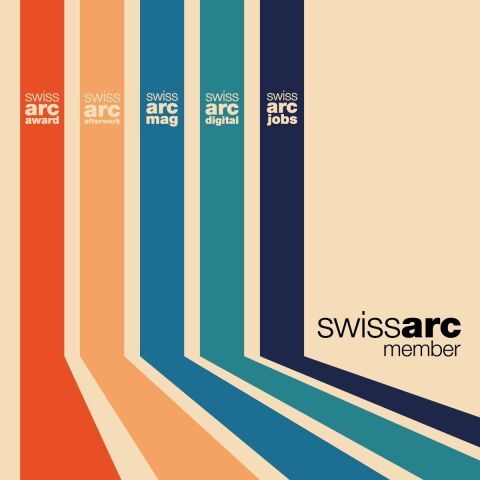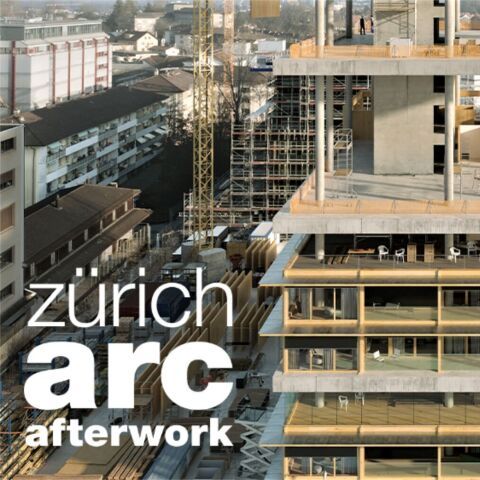Einblicke in die Arbeits- und Gedankenwelt der Ressourcerie – Architektur des Re-Use
Die ehemalige Cardinal Brauerei in Freiburg ist heute ein Innovationsquartier. Das als bluefactory vermarktete Areal ist ein urbanes Labor, in dem Architektur, Ökologie, Forschung, Kreislaufwirtschaft und partizipative Aktivitäten aufeinandertreffen. Nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt hat sich die Ressourcerie eingerichtet, in einem Industriegebäude gleich neben den Gleisen. Das Lager ist nicht angeschrieben. Man betritt es durch unscheinbare Seitentüren, die je nach Besucheraufkommen geöffnet werden. Sobald man eintritt, offenbart sich eine neue Welt.

Das Team der Ressourcerie wurde 2023 mit dem FAS-Preis ausgezeichnet. Dieser würdigt innovative Ansätze in der Architektur. | Foto: Francesco Ragusa
Durch Oberlichter fällt Licht in die Halle. Der Blick streift über aufgereihte Türen, gestapelte Heizkörper, verblichene Sanitärkeramik und gebrauchte, aber sorgfältig sortierte und aufgeschichtete Bretter. Alles ist da, verfügbar, aber provisorisch. Die Atmosphäre ist ruhig, schwebend, beinahe feierlich. Es wirkt, als würden die Materialien leben, aber ihren Atem anhalten. Sie erscheinen wie Charaktere in Wartestellung, die neue Geschichten erleben wollen. Hier ist nichts neu und doch hat alles einen Wert.
Dies ist die Heimat der Ressourcerie, ein fragiles, aber entschlossenes Projekt, geboren aus der Weigerung, Mittäter in der allgegenwärtigen Materialverschwendung im Bauwesen zu sein und dem Wunsch, dem eine Alternative entgegenzustellen. Gegründet 2021 und konkretisiert 2022 von einer Gruppe ehrenamtlicher Architekt*innen, Handwerker*innen, Aktivist*innen und Sozialarbeiter*innen wurde La Ressourcerie im gemeinsamen Bewusstsein gegründet, dass jedes zum Abriss bestimmte Gebäude ein ungehobener Schatz voller grossartiger Materialien ist, die wiederverwendet werden können, und dass es lediglich nötig ist, sie sichtbar zu machen und ihr Potenzial aufzuzeigen. Von Anfang an sollte das Projekt mehr als eine Deponie oder ein hippes Brockenhaus sein. Es ging darum, sorgfältige Prozesse zu etablieren, die nicht nur ein Abbauen, Sortieren und Lagern umfassen, sondern die Materialien als aktive und dynamische Elemente zu begreifen und ihnen die Möglichkeit zu geben, langfristig zu zirkulieren. Damals existierte in Freiburg keine vergleichbare Einrichtung. Man musste das Projekt komplett neu denken und einen Ort, Werkzeuge, Fahrzeuge und eine gemeinsame Sprache dafür finden. Vor allem aber galt es ein «Demontieren statt Zerstören» als kulturelle Praxis (wieder) zu etablieren: ein Waschbecken ausbauen, ohne es zu zerbrechen, ein Fenster entfernen, ohne dass die Scheiben kaputt gehen, eine abgehängte Decke abnehmen, ohne dass sie zerfällt; es sind diese sorgfältigen Gesten, die La Ressourcerie ausmachen.
Sensibilisieren, lagern, aufwerten
Die Arbeit beginnt im kurzen Zeitfenster, in dem ein Gebäude noch steht, sein Abriss aber bereits unausweichlich ist. Das Team muss die passenden Lücken im Abrisskalender finden, bevor die grossen Maschinen eintreffen und die Trennwände herausgerissen werden und alles von Trümmern und Staub verdeckt wird. Diese Arbeit ist methodisch, still und sorgfältig, ein Kontrapunkt in einer Bauindustrie, bei der zur Steigerung der Effizienz Geschwindigkeit der treibende Faktor ist. Was La Ressourcerie bietet, ist eine umfassende Vision der Wiederverwendung, die das gesamte Spektrum aller Leistungsphasen abdeckt, von der Machbarkeitsstudie bis zur Ausführung. Noch bevor demontiert wird, denkt sie mit Architekt*innen und Bauherrschaften über einen strategischen Aktionsplan nach: die Potenziale des Ortes erkennen, künftige Nutzungen antizipieren, lokale Herausforderungen kartieren. Ist dieser Rahmen definiert, folgt das präzise Inventar des extrahierbaren Materials. Danach wird eine aktive Begleitung über die gesamte Projektdauer hinweg eingerichtet: Sie verbindet die Demontage bereits mit zukünftigen Projekten, spinnt einen roten Faden zwischen dem Vorher und dem Nachher, zwischen dem, was entnommen, und dem, was wieder eingebracht wird. Dieser Faden verknüpft die sorgfältigen Demontagen, das Online-Stellen bestimmter Materialien, wenn eine Lagerung unmöglich ist, den kurzfristigen Verkauf spezifischer Stücke. Oft fliessen die Erlöse zurück an die Bauherrschaft, an das Projekt beziehungsweise an das ursprüngliche Team.
Diese Fähigkeit, auf allen zeitlichen Ebenen des architektonischen Projekts zu operieren, ist selten. Sie erfordert eine organisatorische Plastizität, aber auch eine politische und kulturelle Vision: Wiederverwendung als Ökosystem und nicht als einfachen Service zu denken. Von Anfang an bestand der Wille, sich nicht ausschliesslich auf die profitabelsten Aspekte des Re-Use zu konzentrieren. Zwangsläufig ist das Lager ein Ort, der ökonomische Verluste bringt. Demontage, Transport und Lagerung bilden für das Team der Ressourcerie jedoch ein Ganzes. Sie haben eine unsichtbare Architektur entwickelt – aus Verbindungen, Begleitungen, Gesten, Vorwegnahmen – die es ermöglicht, alle Ebenen der Wiederverwendung zuverknüpfen. Und dieser Anspruch stützt sich auf drei Säulen: Sensibilisieren, Lagern und Aufwerten.
Die Sensibilisierung erfolgt durch informelle Gespräche, Austausch und Begegnungen, aber auch durch öffentliche Präsentationen, Kurse für Schulklassen, offene Ateliers und Workshops in den Quartieren, Tage der offenen Tür und kommentierte Besichtigungen.
Das Lager selbst dient als Sensibilisierungsinstrument. Sobald man es betritt, verändert sich zwangsläufig die Wahrnehmung. «Dort zu sein, reicht aus, um uns zum Umdenken zu bringen», sagt Mitgründer Valerio Sartori: «Wenn Leute durch das Lager gehen, bleiben sie stehen: ‹Ah, was ist das?› – ‹Eine Industrieküche.› – ‹Ach ja? Und das hier?› – ‹Alle Türen einer Schule.› Sehr oft gibt es diesen Kippmoment. Ein ‹Ah, wow, okay›. Je mehr man sieht, desto mehr versteht man.» Dieses Bewusstwerden ist grundlegend. Denn tatsächlich ist es schwierig, sich die Dimensionen, Mengen, die Volumina und die Vielfalt der geretteten Elemente vorzustellen; sie zu sehen – das Staunen ist ein pädagogisches Werkzeug, das bildet.
Genau dieses Prinzip war die Leitlinie für die Kernsanierung des Collège du Sacré-Cœur in Estavayer-le-Lac. Am 9. November 2024 organisierte das Team der Ressourcerie einen Vor-Ort-Verkauf in der ehemaligen Schule, in Zusammenarbeit mit den Architekt*innen des Studios WOW, die für das Transformationsprojekt verantwortlich sind. Ziel war es, sichtbar zu machen, was gerettet werden konnte. Einige Räume im Erdgeschoss wurden in thematische Ausstellungen verwandelt: Kabel und Beleuchtung hier, Holzverkleidungen dort, Dämmung, Fenster, gemischte Objekte verteilt auf andere Trakte – eine materielle Kartografie des Gebäudes, Raum für Raum, Stück für Stück. Die meisten Besucher*innen kannten die Schule, hatten dort gelernt, unterrichtet oder waren in der Nähe aufgewachsen. Man zeigte ihnen konkret, was in einer Schule steckt: Hunderte nützlicher und funktionsfähiger Materialien und Gegenstände. Solche Sensibilisierungs- und Einbindungsprojekte sind für La Ressourcerie grundlegend, weil sie bei den Menschen Emotionen wecken und diese erkennen, dass ein Gebäude, selbst wenn es abgerissen wird, noch viel zu geben hat.
Der zweite Schwerpunkt ist die Lagerung, oft «Magazin» genannt, was irreführend ist, da es sich nicht um ein Geschäft im klassischen Sinne handelt. Lagerung ist eine zwangsläufige physische Folge vom Abbauen der Materialien und muss gut koordiniert werden. Ohne Abbau keine Re-Use-Materialien, ohne Kompetenz keine Qualität im Lager – beides ist untrennbar miteinander verbunden.
Der dritte Schwerpunkt ist die Wertschöpfung beziehungsweise der Verkauf. Dieser kann direkt sein, beispielsweise vor Ort in Estavayer-le-Lac, oder indirekt im Rahmen von kleinen bis mittelgrossen Projekten, etwa beim Wiederverwenden einer Küche oder der Aktivierung öffentlicher Räume mit altem Schulmobiliar. Oft arbeitet das Team auch mit Architekt*innen zusammen, die bezüglich Materialien und Beratung anfragen, so geschehen beim beschriebenen Abriss der Schule in Estavayer-le-Lac: Das Team erfasst die Masse und die Ausrichtung von Bauteilen und begleitet den Wiedereinbau der Materialien individuell. Das heisst, der Service geht weit über den eines gewöhnlichen Bauteillieferanten hinaus.
Aufgrund anschwellender Materialzuflüsse wurde im April 2025 eine Person für den Verkauf eingestellt, diese scoutet zudem Elemente, falls Architekt*innen etwas suchen, das nicht auf Lager ist und managt auch den zur Verfügung stehenden Raum, um zu entscheiden, welche Teile dort eingelagert werden können. Dies zeigt eine wichtige Entwicklung in der noch überwiegend ehrenamtlich getragenen Organisation. So wird Wiederverwendung von der Ausnahme zur regulären Architekturpraxis.
Politik des Sichtbaren
Ursprünglich war das gesamte Team der Ressourcerie ehrenamtlich tätig, ohne dass Zuständigkeit und Hierarchien festgelegt wurden. Das Projekt beruhte auf einem Miteinander und Flexibilität. Doch schon bald nahmen die Anfragen zu; die Materialmengen wuchsen; die Einsätze häuften sich. Ohne Struktur ging es nicht mehr. Ein Lager war nötig, es mussten Inventare erstellt, Bestände verfolgt, auf zunehmende Anfragen reagiert und jedes Stück, jede Leuchte, jeder Griff dokumentiert werden. Das Erfassen und Sichtbarmachen zeigte sich als Grundvoraussetzung, dass das Material zirkuliert. Dieser Massstabswechsel – sowohl logistisch als auch menschlich – bedeutete eine Wende für den Verein. Dank Einnahmen aus Demontageleistungen, Inventaren für Bauherrschaften und der Begleitung von Wiederverwendungsprojekten gelang es der Ressourcerie, eine kleine finanzielle Reserve aufzubauen. Seit Januar sind acht Personen angestellt, mit variierenden Stelleprozenten zwischen zehn und sechzig. Das entspricht rund 2,7 Vollzeitstellen. Das ist wenig im Angesicht der Arbeitslast, jedoch grundlegend. Es hat alles verändert. Denn jetzt kann das Team planen, Aufgaben verteilen, Termine besser halten und weiter vorausdenken. Und vor allem: Es kann sich auf engagierte und bezahlte Personen verlassen. Eine Form von Stabilität hat sich eingestellt, ohne dass der kollektive Schwung der Anfangszeit verloren gegangen wäre.
Bei La Ressourcerie sind alle Löhne gleich – unabhängig von der wahrgenommenen Funktion – ob auf der Baustelle, in der Demontage oder im Büro in der Planung. Das ist nicht symbolisch, sondern die Umsetzung eines gesellschaftspolitischen Anspruchs. «Das war ein Grundsatzwunsch», erklärt Valerio, «wir haben die Vereinsform gewählt, weil sie unseren Werten entspricht. Und wir haben beschlossen, dass die ersten bezahlten Personen diejenigen sein sollten, die demontieren. Das ist etwas gegen den Strom. Üblicherweise werden diejenigen bevorzugt, die sprechen, präsentieren, repräsentieren. Wir sagten uns jedoch: Ohne das Material existieren wir nicht.»

Die Ressourcerie engagiert sich auch auf sozialer Ebene, indem sie offene, partizipative und pädagogische Veranstaltungen organisiert. Über die Wiederverwendung von Materialien hinaus schafft sie Räume, in denen sich Menschen treffen und ihr Wissen und ihre Ideen weitergeben können. | Photos © La Ressourcerie
Zwei Orte, zwei Massstäbe
Herz ist das beschriebene, 800 Quadratmeter grosse Lager. Hinzu kommen 180 Quadratmeter Logistikfläche bei den Bahngleisen. Und das ist noch nicht alles: Am 6. September wird in La Poya in einer ehemaligen Kaserne im Herzen von Freiburg ein weiterer Standort eröffnet. Die Ressourcerie wird 450 Quadratmeter der Hallen, die sich im Besitz des Kantons befinden, anmieten und zu einem «Schaufenster des Wiederverwendens» machen. Jeden Donnerstag und Samstag sollen Besucher*innen empfangen werden.
Hier ist alles auf Pädagogik und Vermittlung ausgerichtet. Besucher*innen finden dort eine Auswahl an Materialmustern sowie eine Werkstatt zur Verarbeitung von Holz und Metall. Dies erlaubt es, die gekauften Materialien unmittelbar vor Ort zuzuschneiden oder umzuarbeiten. In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen – die sich ebenfalls in La Poya angesiedelt haben. Der neue Standort wurde strategisch gewählt. Er soll das Projekt einer breiten Öffentlichkeit nahebringen, niederschwellig und inklusiv sein. Ein Besuch im Lager soll das Potenzial und den Reiz des Wiederverwendens für jeden greifbar machen. Er richtet sich bewusst nicht nur an Architekt*innen, sondern ist eine Anlaufstelle für die ganze Bevölkerung. Es sollen nicht nur konkrete Fragen beantwortet werden, sondern Raum zur sozialen Interaktion geschaffen werden. Mit La Poya kommt nicht nur ein zweiter Standort hinzu, es wird ein ganz neuer Massstab eingeführt. Es ergänzt das bestehende Lager in der ehemaligen Brauerei, ohne es zu ersetzen. Der alte Standort dient vor allem für sperrige und schwere Elemente, die für die Verwendung im Rahmen grösserer Re-Use-Projekte gedacht sind, während La Poya ein Ort der Begegnung, der Zirkulation und der direkten Transformation wird.
Die Dualität von Lager und Schaufenster macht die gesamte Wertschöpfungskette der Wiederverwendung sichtbar: Entnahme, Dokumentation, Lagerung, Weitergabe, Transformation. Sie ermöglicht auch die Einbindung weiterer Partner*innen und die Entwicklung öffentlicher Formate, durch die erreicht werden kann, dass das Thema möglichst vielen Menschen im Alltag begegnet.
La Ressourcerie versucht sich zudem so stark wie möglich mit Akteur*innen in den Bereichen Ausbildung und Bildung zu vernetzen. Sie arbeitet unter anderem eng mit der HEIA, der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg, zusammen. Seit zwei Jahren kommen alle Erstsemester – sowohl Ingenieur*innen als auch Architekt*innen – mindestens einmal zur Ressourcerie. Die Hochschule organisiert Sensibilisierungsmodule zur Nachhaltigkeit und eines davon findet in den Räumen der Ressourcerie statt. «Sie kommen physisch hierher, noch bevor sie ihr Studium beginnen», präzisiert Valerio. Er selbst unterrichtet dort im Masterstudium, wo er die Themen Materialflüsse, Re-Use und Konstruktion vermittelt. Diese Verbindung ist organisch. Workshops des zweiten und dritten Studienjahres arbeiten häufig in der Ressourcerie, oder die Studierenden holen sich dort Material für ihre Projekte. Es ist eine verkörperte, direkte Pädagogik.
Politik und Normen schwenken ein
Mittlerweile kommen auch Vertreter*innen verschiedener Institutionen aus den Bereichen Umwelt, Bauwirtschaft und Nachhaltigkeit zu Besuch; sie beobachten und stellen Fragen. Diese Entwicklung ist Teil eines wichtigen breiteren Wandels, der nun auch auf regulatorischer Ebene zu greifen beginnt. Nachdem die meisten Player, welche für das Etablieren technische Normen zuständig sind, lange taub für Fragen der Wiederverwendung waren, scheint nun das Eis gebrochen. Dieser Prozess wirkt noch zaghaft, aber immerhin ist er in Gang gekommen. Einige SIA-Normen haben mittlerweile die Frage der Wiederverwendung von Materialien integriert. Es gibt zwar noch keine Verpflichtungen und doch geht es in die richtige Richtung. Bereits die Präsenz des Themas Re-Use in Labels, Bewertungsschemas oder Indikatoren schafft einen Sogeffekt.
Denn Normen sind gegenüber Investor*innen und Bauherrschaften ein wichtiger Hebel. Im Sinne von Gütesiegeln können sie sichtbar und damit auch vermarktbar machen, was bislang verborgen war. Man kann die Macht von Normen daher gar nicht hoch genug einschätzen. Nur was in Texten verankert ist, wofür es für die Bauwirtschaft sichere Rahmenwerke gibt, wird auch auf den Baustellen umgesetzt.
Dies alles muss im Kontext der zunehmenden wirtschaftlichen und ökologischen Spannungen gelesen werden: Verzögerungen in den Lieferketten, explodierende Rohstoffpreise, Wohnungsnot und vor allem die Ziele zur Verringerung des CO2-Ausstosses. Mehrere Schweizer Kantone streben Klimaneutralität bis 2040 an, andere bis 2050. Im Massstab des Bauens ist das übermorgen. Und das ändert alles. Der aktuell noch grassierende Abriss muss zum überholten Luxus werden – nicht nur moralisch hinterfragt, sondern auch regulatorisch erschwert oder im Idealfall verunmöglicht. Bestehende Strukturen weiterzunutzen und Bauteile wiederzuverwerten, ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist Wiederverwendung keine Alternative, sondern muss zur Selbstverständlichkeit für die Gegenwart und Zukunft des Bauens werden. Die SIA-Norm 390/1, erschienen im Februar 2025, besiegelt diesen Wandel. Sie ersetzt das technische Merkblatt SIA 2040 aus dem Jahr 2017 und bietet nun einen klaren Rahmen für die Erstellung einer Treibhausgasbilanz für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Das Ziel: die Baupraktiken mit den Klimazielen der Schweiz und denen des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen. In diesem neuen Rahmen werden die Treibhausgasemissionen zur wichtigsten Masseinheit, während die nicht erneuerbare Primärenergie nur noch sekundär aufgeführt ist.
Die Norm SIA 430 hingegen markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Baustellenabfallbewirtschaftung. Während die frühere Empfehlung von 1993 bereits die Bedeutung eines zirkulären Ansatzes betonte, macht die überarbeitete Version von 2023 – SIA 430:2023 – die Begrenzung und Bewirtschaftung von Baustellenabfällen zu einem zentralen Ziel. Die Reduktion der Abfälle, ihre Trennung und Verwertung werden nun nicht mehr als freiwillige «gute Praktiken», sondern als normative Imperative behandelt. In diesem regulatorischen Ökosystem erhalten Praktiken wie jene der Ressourcerie ihre volle Bedeutung.
Die Ökonomie der Ressourcerie ist eine der Fürsorge; sie arbeiten mit Achtsamkeit und Geduld. Sie stellen dem industriellen Primat der Effizienz eine Ethik der Dauerhaftigkeit gegenüber. Ein Gegenmodell, das öffentliche Unterstützung und politische Anerkennung voraussetzt.
Diese wächst: 2023 erhielt La Ressourcerie den FAS-Preis (Fédération des architectes suisses), eine Auszeichnung, welche die Innovation und soziale Relevanz ihrer Praktiken würdigt. Eine symbolische, aber auch strategische Anerkennung: Sie verankert die Arbeit des Kollektivs in einer professionellen und institutionellen Landschaft und gibt damit dem beginnenden Wandel Rückenwind.

Die Erweiterung der Manufaktur in Lausanne ist eine Zusammenarbeit mit TRIBU Architecture und dem Team von 2401. | Foto © TRIBU architecture
Eine Welt voller Möglichkeiten
Bei La Ressourcerie entstehen Projekte stets aus einer Sensibilität für den Kontext, für das, was da ist – ein zum Abriss bestimmtes Gebäude, ein leerer Raum, ein gerettetes Material. Einige – wie Installationen, Möbel und Szenografien – werden intern initiiert und auf dem Gelände in Freiburg realisiert. Sie ermöglichen es, die Potenziale der Wiederverwendung im kleinen Massstab zu erforschen. Man erprobt leichte und anpassungsfähige Formen, wie «La Tablançoire» oder «La Fusée Bleue», entworfen aus wiederverwendeten Materialien.
Parallel dazu kooperiert La Ressourcerie bei Projekten mit externen Partnern – etwa Architekturbüros oder öffentlichen Institutionen. Aktuell arbeiten sie zum Beispiel mit Tribu architecture an einer Erweiterung der Manufacture, dem Standort der Haute école des arts de la scène in Lausanne, mit Tanz- und Theaterstudios. Bei diesem Vorzeigeprojekt zum zirkulären Bauen spielt La Ressourcerie eine zentrale Rolle, indem sie gebrauchte Materialien liefert, insbesondere Stahlträger aus einer ehemaligen Industriehalle. Diese Elemente wurden sorgfältig ausgewählt, geprüft und von den Ingenieur*innen von 2401 in enger Koordination mit La Ressourcerie in die neue Struktur integriert. Das Stahltragwerk des Gebäudes – ein Rahmen von 15 x 18 x 9 Metern – besteht zu circa 80 Prozent aus wiederverwendeten Materialien, darunter HEA 240 und IPE 140-Träger, was die technische und strukturelle Machbarkeit des Wiedernutzens grossformatiger Bauteile eindrucksvoll vor Augen führt. Diese Zusammenarbeit wird helfen, dem Re-Use weiteren Auftrieb zu verschaffen. Beide Projekttypen – interne und externe – zeugen vom praktischen wie politischen Engagement der Ressourcerie und ihrem Ziel, Wiederverwendung als Hebel zu nutzen, um Bauweisen, Wohnformen und das Denken über Raum zu transformieren.
Der Text wurde für das Swiss Arc Mag 2025–5 verfasst und von Jørg Himmelreich ins Deutsche übersetzt.
Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.