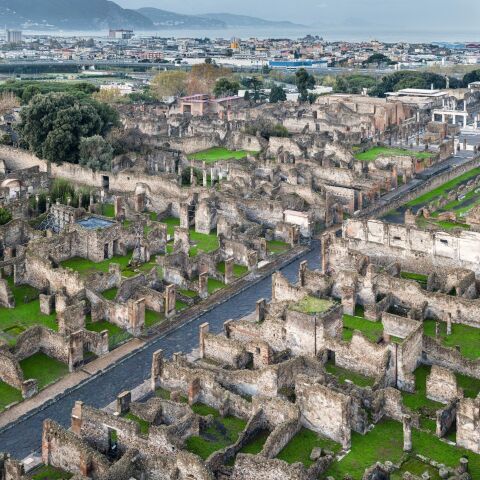«The World’s Greatest Show»
Seit Oktober letzten Jahres begrüsst die Expo 2020 in Dubai Besucher*innen aus aller Welt. Bei den Präsentationen unter dem Motto «Connecting Minds. Creating the Future» stehen vor allem die Krisen von Klimawandel, schwindender Biodiversität, Ressourcenknappheit und sozialer Ungleichheit im Zentrum. Überlagert von multimedialem Theaterdonner und Marketingrhetorik ist es jedoch schwierig, die wenigen brauchbaren Ansätze zu deren Linderung herauszufiltern. Die Weltausstellung ist einmal mehr vor allem ein Instrument der Beschwichtigung – und dasselbe gilt auch für ihre Architekturen.

Die Expo 2020 aus der Vogelperspektive in einer offiziellen Visualisierung aus dem Jahr 2019.
Eigentlich sollte die Expo bereits 2020 starten. Dass sie erst ein Jahr später ihre Tore öffnen konnte, ist der Corona-Pandemie geschuldet. Um keinen Wirrwarr beim Brand zu erzeugen, wurde der Name Expo 2020 beibehalten. Bis zum 31. März kann die Schau besucht werden. Geboten werden Superlative auf vielen Ebenen: Mit einer Fläche von 438 Hektaren ist die Expo doppelt so gross wie die in Mailand und sieben Milliarden Schweizer Franken haben die Vereinigten Arabischen Emirate sie sich kosten lassen. Wissend, dass viele Weltausstellungen hinter den Besucherprognosen zurückblieben, erwartet man in Dubai 25 Millionen Menschen und hofft, dass die Expo der lokalen Wirtschaft Mehreinnahmen von mehr als 33 Milliarden Schweizer Franken bescheren wird. Bislang läuft es gut: In den ersten zwei Monaten besuchten fünf Millionen Gäste die Schau. Weil die Emirate ihre Bevölkerung konsequent gegen Corona geimpft haben, konnte im Herbst die Tourismusmaschinerie wieder voll angeworfen werden. Während in vielen anderen Ländern die Fallzahlen erneut in die Höhe schnellten, fielen sie in Dubai annähernd auf null. Nur die Omikron-Mutante könnte dem Erfolg der Expo wohl noch einen Strich durch die Rechnung machen.
(Verstummte) Kritik
Mit Dubai findet zum ersten Mal eine Weltausstellung im Mittleren Osten statt. Die Emirate konnten sich 2013 beim Bureau International des Expositions gegen Russland, Brasilien und die Türkei als Austragende durchsetzen. Keine einfache Wahl, wenn zwei Protodiktaturen und eine absolute Monarchie, in der systematisch Menschenrechte verletzt werden, im Rennen sind. Kritik war in den folgenden Jahren der Expo-Planung jedoch nur wenig zu hören. Zwar beschuldigte beispielsweise das Europäische Parlament mehrere VAE-Baufirmen der Ausbeutung von Arbeiter*innen, weil Pässe eingezogen, unübersetzte Verträge mit vielen Arbeitsstunden untergeschoben und unwürdige Unterkünfte bereitgestellt würden. Der Aufruf des EU-Parlaments an Länder und Firmen die Expo zu boykottieren, traf jedoch fast ausschliesslich auf taube Ohren. 192 Länder sowie 70 NGOs und Konzerne präsentieren sich derzeit in Dubai mit eigenen Pavillons oder in Gebäuden, die ihnen zur Verfügung wurden.
Gesamtkunstwerk
Springen wir von den ethischen Abgründen zum gestalterischen Höhepunkt: Meisterwerk der Expo ist ihr Gesamtplan, den HOK aus London gemeinsam mit Populous und ARUP entwickelt haben. Ein zentraler, Al Wasl genannter Platz (arabisch für «Verbindung») wird von drei Themenarealen und zwei Parks umringt. Im Luftbild sieht das wie eine Blume mit fünf Blütenblättern aus. Damit knüpfen die Planer*innen an die räumliche Organisation früherer Weltausstellungen an, etwa jener in New York von 1939 und verweisen zugleich auf Layouts von Themenparks wie Disneyland. In frühen Präsentationen der Expo wurden die radialen und konzentrischen Hauptwege von geschuppten Dächern verschattet, die sich über dem zentralen Platz zu einem Kegel aufschieben und mit Solarpaneelen ausgestattet 50 Prozent der von der Expo benötigten Energie hätten liefern sollen. Doch wurde diese wie eine riesige Origami-Krake aussehende Figuration zugunsten einer kugelförmigen Kuppel im Zentrum und horizontaler Sonnensegel über den Wegen aufgegeben. Das Ergebnis ist dennoch überzeugend: Alle Länderpavillons liegen an den breiten Boulevards aufgereiht. Es gibt nur Rundwege und keine Sackgassen.
Die drei Themenareale haben ikonische Hauptpavillons. «Alif» im Bereich Mobility, der wie ein riesiger silberner Fidget Spinner aussieht, wurde von Foster+Partners gestaltet. Grimshaw Architects haben «Terra» für den Sustainability-Bereich gestaltet. Während die Ausstellungsräume hauptsächlich in einer künstlichen Landschaft verborgen liegen, wird der Pavillon von einem Tornado aus Stahl überragt, der von Solarzellen bedeckt ist und von pilzartigen Strukturen begleitet wird, die Schatten spenden und ebenfalls mit Solarzellen bestückt zugleich Sonnenenergie ernten. Und schliesslich ist da noch der Opportunity Pavillon aus der Feder von AGi Architects mit seinen schwebenden Dächern, die besonders bei Nacht violett beleuchtet beeindrucken.
Betritt man das Expo-Gelände von den Parkplätzen kommend, wird man von diesen «Weenies» optisch in das Gelände hineingezogen und kann sich auch beim Verlassen des Geländes wieder gut an ihnen orientieren, sodass man leicht zum eigenen Fahrzeug zurück findet.
Verglichen mit Dubai hatten die Expos in Hannover, Shanghai und Mailand mit ihren orthogonalen Rastern eher den Charme von Gewerbeparks. Zu deren Ehrenrettung muss jedoch gesagt werden, dass sie bestehende Messegelände und (Verkehrs-)Infrastrukturen adaptiert haben, während die Weltausstellung in Dubai auf ein vormals leeres Gelände wortwörtlich «in die Wüste» gesetzt wurde. Doch längst hat das rasch wachsende urbane Gefüge von Dubai auch dort im Süden weitergewuchert und beginnt die Flächen Richtung Westen zum Tiefseehafen Dschabal Ali und nach Süden zum zukünftigen Dubai World Central Airport aufzufüllen, der 2027 fertig und kapazitätsmässig der grösste Flughafen der Welt werden soll.
Von sorgfältig gestalteten und verschatteten Aussenräumen mit ansprechenden Bodenbelägen und hübschen Bepflanzungen, über vielfältigen Sitzgelegenheiten bis zu zahlreichen Trinkwasserbrunnen wurde bis ins Detail alles gut durchdacht. Ein Besuch ist so selbst an einem Tag mit Temperaturen über 30 Grad Celsius angenehm. Alternativ kann man natürlich auch erst nach Sonnenuntergang auf das Gelände kommen. Die Pavillons sind bis 22 Uhr geöffnet und ausgeklügelte Beleuchtungen und Lichteffekte machen die Expo in der Nacht zu einem magischen - vielleicht mitunter etwas allzu bunten - Erlebnis.

Musterschüler Deutschland: Als einer der wenigen Pavillons präsentiert das Land neue Technologien für die Energiewende. Beispielsweise wie man Energie aus Wind- und Solarenergie mit Vakuumkugeln im Meer oder Kalk speichern könnte. Den Pavillon haben LAVA gemeinsam mit Facts and Fiction und Nüssli Adunic gestaltet. ©Jørg Himmelreich
Sphäre, Falke, Wasserfall
Die Expo 2020 hat keinen Eiffelturm oder ein Atomium zu bieten. Aber im Zentrum stehen drei Bauwerke, die durchaus das Potenzial haben, Wahrzeichen zu werden. Da ist allen voran das 70 Meter hohe Dach über dem Al Wasl-Platz von Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Wie eine in die Erde eingesunkene Kugel mit 150 Metern Durchmesser ist sie als halbverschatteter Platz das Herz der Weltausstellung. In der Nacht werden bewegte Bilder auf die Innenseite projiziert. Begleitet von Klängen bietet sich so ein beeindruckend immersives Erlebnis. Begehbare Hohlkugeln sind seit der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 aus dem Kanon der Weltausstellungsarchitekturen nicht mehr wegzudenken. In Dubai dient der Globus als Metapher der eigenen Bedeutung und Grösse. Die ganze Welt versammelt sich hier, im neuzeitlichen Hub zwischen Asien, Afrika und Europa. Indem man die zentrale Attraktion als frei zugängliche Plaza gestaltete, vermied man die Fehler vorheriger Expos, wo sich vor den architektonischen Wahrzeichen mitunter Schlangen bildeten. Die Kugel in Dubai erzählt aber zugleich auch vom Werteverfall dieser architektonischen Bilder. Stand beispielsweise die Kugel der Perisphere 1939 in New York mit dem darin gezeigten Modell der sogenannten Democracity - einer Stadt der Zukunft mit einem Hochhaus im Zentrum - für die Hoffnung auf eine demokratische Welt der Zukunft, sind diese Zeichen in Dubai nun zu den Insignien einer absoluten Monarchie verkommen: Zu den weltweit bekannten Symbolen eines Landes, das Steueroase für Firmen und reiche Privatpersonen ist, während Gastarbeiter dort für monatlich 175 US-Dollar auf den Baustellen schuften. Und auch konstruktiv und formal gibt es Unterschiede zu vergleichbaren Expo-Vorgängerbauten. Bei Buckminster Fullers geodätischer Kuppel des US-Pavillons in Montreal 1967 ging es beispielsweise um die Minimierung der Materialmenge. Die Kugel-Kuppel in Dubai zeigt hingegen eine andere Haltung: Gegliedert in Kreise, Rhomben und Bögen wirkt sie wie eine Laterne aus Tausendundeine Nacht, die das Märchen des kometenhaften Aufstiegs der VAE erzählt.
Ähnlich bildhaft gibt sich der Pavillon der vereinigten Arabischen Emirate, der gleich neben der zentralen Plaza errichtet wurde. Gemäss Architekt Santiago Calatrava soll er an einen Falken erinnern. Insofern als dessen Schwingen herunterhängen, erinnert er mehr an eine geschlagene Taube oder welke Blume. Unabhängig von dieser Metapher verströmt er eine Aura der Zuversicht. Betritt man am Ende der Pavillon-Tour die grosse zentrale Kuppelhalle, kann man sich ihrer feierlichen Wirkung nicht entziehen.
Der dritte grosse Bau im Zentrum ist das sogenannte Water Feature. Dieser von WET gestaltete vulkanförmige Platz bietet ein gewaltiges Wasserspiel. In einer sechsminütigen Show rauschen Wasserfälle begleitet von pompöser Musik die gerundeten Wände hinab; nachts noch gesteigert in seiner Wirkung durch Projektionen. Offiziell soll dies auf den Wert von Wasser an diesem äusserst trockenen Ort aufmerksam machen. Die Wirkung ist aber eine andere. Wie einst in den Gärten des Barocks erzählt diese Anlage von der Allmacht seiner Auftraggeber, die es geschafft haben, die Wüste in eine Oase mit rauschenden Fontänen zu verwandeln.
Architektur der Beschwichtigung
Die Länderpavillons wetteifern ebenso um die Aufmerksamkeit der Besucher*innen. Nur wenige ragen architektonisch heraus oder bieten interessante Raumerlebnisse. Am angenehmsten sind jene, die verschattete Aussenräume statt hermetisch geschlossener Boxen bieten, etwa der Pavillon Brasiliens (JPG.ARQ, MMBB Arquitetos, Ben-Avid), dessen Membran ein flaches Wasserbecken verschattet, in dem sich die Besucher*innen beim Hindurchwaten abkühlen können. Viele der Länderpavillons sind aber lediglich «dekorierte Schuppen», geschlossene und klimatisierte Boxen, in denen aufwändige Filmprojektionen gezeigt werden. Zukunftsweisendes wird bei der Architektur kaum geboten. Die additiven Hüllen dienen wiederum als Zeichen. Sie sollen verheissungsvolle, positive Versionen der Zukunft zeichnen und von Prosperität, Wohlstand, und dem Einklang der Menschen mit der eigenen Geschichte und Natur berichten. Das ist in Dubai nicht anders als auf den Expos in den Jahrzehnten zuvor. Weltausstellungen sind diesbezüglich eher mit dem Drag eines Eurovision Song Contest zu vergleichen als mit den sportlichen Höchstleistungen bei einer Olympiade. Winfried Kretschmer beschrieb in seinem 1999 erschienenen Buch über die «Geschichte der Weltausstellungen» diesen «Trend zum Vergnügungsspektakel, hin zu einer gigantischen, aber belanglosen Zusammenballung aller möglicher Neuerungen und Kuriositäten.» Auch in Dubai nutzen die Länder ihre Pavillons mehr für Standortmarketing und Tourismuswerbung denn zur Reflexion über dringende Probleme. Entsprechend sind die Exponate mehr Kunst als Innovation, mehr Konzept als Erfindung. Man scheint vor allem drauf erpicht, den Besucher*innen zu versichern, dass der Lifestyle der ersten Welt auch zukünftig noch möglich sein wird oder gar noch qualitativ gesteigert werden könne. Nimmt man die gebotenen Narrationen ernst, dann sind die Regierungen weltweit bereits erfolgreich daran, Wirtschaft und Landwirtschaft nachhaltig umzugestalten. Wie genau, wird jedoch nicht klar und die gezeigten Beispiele von Hyperloop, Solarkraftwerken oder Baumaterialien aus Pilzen wirken eher wie Alibis und Hoffnungssymbole, denn wie Lösungen.

Künstliche Intelligenz und digitale Fabrikation sind als Themen auf der Expo annähernd inexistent. Der Pavillon des Vereinigten Königreichs von Künstlerin Es Devlin nimmt sich hingegen dem Thema auf poetische Art an: Ein Computer arrangiert von den Besucher*innen eingegebene Wörter zu Gedichten, die innen und aussen auf dem Pavillon gezeigt werden. ©Jørg Himmelreich
Welche Nachhaltigkeit?
Noch in den 1960er-Jahren war Dubai eine verschlafene Kleinstadt in der Wüste. Mittlerweile ist es zu einer globalen Megacity mit 3,4 Millionen Einwohnern angewachsen. Der Energie- und Wasserverbrauch für die gläserne Stadt in der Wüste ist immens. Dass ein Staat wie die UAE, wo die Bürger*innen einen der grössten ökologischen Fussabdrücke weltweit haben, eine Expo durchführt, bei der Nachhaltigkeit im Zentrum steht, wirkt daher auf den ersten Blick ironisch. Dieser Fokus ist zuerst einmal den Vorgaben geschuldet. 1994 wurde vom BIE festgelegt, dass Expos drängende «Probleme der Gegenwart», wie etwa die Herausforderung des Umweltschutzes adressieren sollten. Entsprechend fokussierten die Schauen in Shanghai 2010 auf Urbanismus und in Mailand 2015 auf Fragen der Ernährung.
Doch in Dubai gibt es tatsächlich politische Bestrebungen bis 2050 zur «Greenest City on Earth» zu werden. Auf der Expo wird in diesem Kontext beispielsweise die neue Metro thematisiert (immerhin transportiert sie stündlich 13 000 Personen) und Projekte zum Recyceln von Grauwasser. Dass Dubai dafür aber auch mehrere Atomkraftanlagen bauen wird, um die CO2-intensive Energiegewinnung aus Gas und Öl zurückzudrängen, kommt nicht zur Sprache. Dieses Beispiel steht exemplarisch für die Krux der gesamten Expo. In fast allen Pavillons wird den Besuchern eine schöne nachhaltigere Welt versprochen. Mit welchen neuen Technologien und Infrastrukturen dies passieren soll, wird jedoch fast komplett verschwiegen. Und wie diese sich auf Landschaften und Ökosysteme auswirken, wird ebenso grosszügig ausgeklammert. Das legt offen, dass die meisten der Präsentationen bloss Greenwashing sind. Tausende von Klimaanlagen (mit denen etwa wie beim Schwedischen Pavillon sogar die Aussenluft gekühlt wird), Millionen Stücke Wegwerfbesteck und Einweggeschirr oder Souvenir-Trash im Terra Pavillon, erhältlich nachdem man über gigantische Plastikberge im Ozean aufgeklärt wurde, machen die Nachhaltigkeitsrhetorik ganz unmittelbar zu einer Farce.

Viele Länderpavillons spielen mit Naturmetaphern. Entweder verstehen sie ihre Form als Analogie, wie beispielsweise der Pavillon der Philippinen von Budji Layug + Royal Pineda, der von Korallenriffen inspiriert ist. Oder sie wollen eine zweite artifizielle Natur bereitstellen, wie der vertikale Garten von Singapur. Es wird vorgerechnet, wie viel CO2 die Pflanzen binden. Graue Energie, die zum Errichten nötig war, wird jedoch nicht ausgewiesen. ©Jørg Himmelreich
Nachleben
Aller Kritik an der Expo zum Trotz: Ein Versprechen scheint sie zu halten. Unmittelbar nach Schliessen der Expo Ende März soll das Gelände in ein neues Stadtquartier umgewandelt werden. Im sogenannten District 2020 sollen 85 Prozent aller für die Weltausstellung errichteten Strukturen weitergenutzt werden. Hopkins Architects werden neue Wohn- und Geschäftshäuser inklusive Co-Working-Spaces und neue Hotels bauen. 145 000 Einwohner*innen sollen zukünftig dort leben und sich zu Fuss, mit dem Rad, öffentlichen Verkehr oder mit selbstfahrenden Mobilen fortbewegen. Die Büros und Schauräume in den Zentren der drei Themenareale bleiben bestehen und werden zukünftig vermietet. Auch die zentrale Kuppel, das Water Feature und der UAE-Pavillon sollen erhalten bleiben und zu Kulturzentren und Museen werden. Des Weiteren soll der Exhibition Centre bei der Metro Station massiv erweitert werden und zukünftig 45 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bieten. Dass Firmen und Privatpersonen im District 2020 keine Steuern zahlen, soll dem neuen Quartier zum Durchstarten helfen.
Text: Jørg Himmelreich