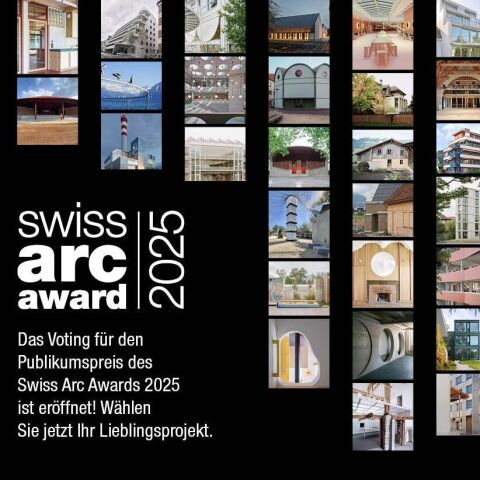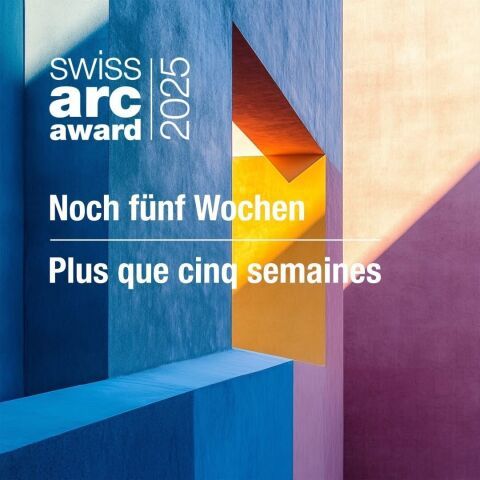Lifetime Achievement Award 2025 – Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert im Gespräch mit Jørg Himmelreich

Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert | Foto: Daniel Villiger
Das architektonische Werk von Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert aus Zürich zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Balance von Ästhetik, Funktionalität und Sensibilität für den Kontext aus. Mit ihren Bauten in Zürich und Umgebung haben Knapkiewicz & Fickert seit den 1990er-Jahren einen wertvollen Beitrag zur zeitgenössischen Architektur geleistet und Generationen von Architekt*innen beeinflusst.
Jørg Himmelreich Die Redaktion gratuliert Euch von Herzen zur Auszeichnung mit dem Lifetime Achievement Award 2025. Gerne möchten wir im Gespräch verschiedene Schwerpunkte in Eurem Werk beleuchten, herausfinden, welche Themen und Fragestellungen Eure Arbeit geprägt haben und was Euch aktuell beschäftigt. Könnt Ihr zum Einstieg ein wenig über Euren persönlichen und beruflichen Hintergrund erzählen?
Kaschka Knapkiewicz Ich komme ursprünglich aus Winterthur; dort bin ich aufgewachsen. Mein Vater war polnischer Internierter und meine Mutter stammt aus dem Tösstal. Ich habe an der ETH Zürich Architektur studiert. Dort habe ich auch Axel kennengelernt. Nach der Ausbildung habe ich drei Jahre in London gearbeitet, unter anderem bei Zaha Hadid. Ich war ihre erste Angestellte. Dann war ich noch eine Zeit lang in Berlin mit meinem damaligen Partner.
Axel Fickert Ich stamme aus Ostbayern, einem Ort nahe der tschechischen Grenze. Ich bin seit 52 Jahren in der Schweiz. Ich habe ebenfalls an der ETH Zürich studiert. Wenn man von weit weg kommt, dann bleibt man eigentlich ein Fremder.

Siedlung Hornbach, Zürich, 2021 | Foto: Seraina Wirz
Warum betonst Du das?
AF Man kann ewig in der Schweiz leben und doch nie richtig ankommen. Doch dieser Schwebezustand des Ewig-Suchenden ist eigentlich etwas Gutes. Am Anfang habe ich diejenigen beneidet, die eine feste Identität hatten. Besonders sind da die Luzerner Kolleg*innen hervorgestochen. Die waren felsenfest mit ihrer Region verwurzelt. Sie hatten Architektur, an die sie anknüpfen konnten – beispielsweise die Luzerner Version des ligurischen Badehäuschens. Ich hingegen musste immer suchen. Wo stehe ich? Auf was kann ich mich beziehen? Diese Suche nach etwas «Identifizierbarem» hat nie aufgehört. Irgendwann habe ich versucht, meine alte Heimat, die wegen meines frühen Weggangs nie ganz eine war, zu mystifizieren – wie in einer Art Roman oder einem Theaterstück. Ich habe eine Kulisse entwickelt, mit der ich arbeiten kann. Das hat mir die Fähigkeit gegeben, auch mit anderen Szenerien sehr gut umgehen zu können.
Ihr habt zeitgleich an der ETH studiert. Wer waren Eure Lehrer*innen oder Vorbilder und welche Themen oder Ansätze haben Euch geprägt?
KK Ich hatte ein grosses Interesse an Le Corbusier und später Aldo van Eyck, der an der ETH unterrichtet hat. Wie er über Architektur diskutierte und sie entwickelte und seine bildhaften, präzisen Kritiken unserer Arbeiten haben mir Impulse gegeben, die mich bis heute begleiten. Ich war zudem von klassischer Architektur fasziniert – von Karl Friedrich Schinkel, John Soane und Leo von Klenze. Bei Axel war es anders. Er fand es irgendwie daneben zu entwerfen und zu zeichnen. Es war erst im Rahmen des Diploms, dass er anfing, Pläne zu zeichnen.
AF Ein paar Pläne habe ich vorher schon gezeichnet. Aber ich habe während dem Studium tatsächlich vor allem Schreibmaschine geschrieben. Es war damals – vielleicht nicht unbedingt eine revolutionäre, aber zumindest doch – eine aufgeregte Zeit. Mir ging es wie vielen anderen nicht um die Form der Architektur, sondern um Gesellschaftliches. Ich war der Meinung, dass man mit Architektur nichts verändern beziehungsweise dass sie keinen Beitrag leisten kann. Ich bin irgendwie komisch berührt, dass aktuell wieder das Gleiche passiert: Architektur spielt eigentlich keine Rolle mehr, Gesellschaft ist alles.
KK Wir kennen uns seit 1972, haben aber zuerst nicht zusammengearbeitet. Seit 1992 betreiben wir unser gemeinsames Büro in Zürich. Wir waren immer ein bisschen konträr. Aber das war und ist auch der Nährboden für viele gemeinsame Diskussionen.
AF Wir haben noch im ETH-Hauptgebäude im Zentrum von Zürich studiert. Das heisst, die Altstadt mit ihren Bars war nicht weit. Man kann sagen, dass wir eigentlich in den Bars voneinander lernten, indem wir dort miteinander gestritten haben – unter anderem in der Buvette des Hotels zum Storchen, die damals noch anders aussah.
Aber offensichtlich hast Du dann doch irgendwann angefangen zu entwerfen, Axel.
AF Das dauerte aber eine Weile. Ich habe einen Wandel durchgemacht im Studium. Irgendwann kam Aldo Rossi als Gastdozent an die ETH – da war es um mich geschehen und ich habe mit Architektur angefangen. Er brachte etwas Neues ein und war meine Brücke zur Architektur. Auch Paul Hofer hat eine wichtige Rolle gespielt. Er war Historiker, unterrichtete Städtebaugeschichte und hat uns eine profunde Kenntnis von der historischen Stadt vermittelt und das Interesse an ihr geweckt. Wir haben damals ein Relievo – einen zusammenhängenden Grundrissplan ähnlich dem Rossi-Plan von Zürich – gemacht, aber dieses mal von Solothurn. Und das hat mir eine super Grundlage gegeben für alles Spätere. Mit vielen Highlights der Architektur bin ich aber erst durch Kaschka in Kontakt gekommen.
Was ist im Rückblick für Euch persönlich das Prägendste an Rossis Lehre gewesen?
AF Architektur ist nach Rossis Lehre durch ihre Geschichtlichkeit autonom, das heisst sie reproduziert sich kontinuierlich selbst. Und Rossi hat uns aufgezeigt, dass der gesellschaftliche Aspekt immer in ihr steckt, also inkorporiert ist – seit Jahrhunderten beziehungsweise Jahrtausenden. Wobei er damit nicht meinte, dass sie komplett starr ist, sondern dass die Architektur sich langsam, aber kontinuierlich mit der Gesellschaft verändert. Diese Idee, dass die Architektur eine Disziplin für sich ist und nicht bloss eine Art Ableitung anderer Disziplinen, haben damals viele provokant gefunden. Doch wir hängen diesem Gedanken noch immer nach. Wir reden bei unseren eigenen Bauten nicht gross davon, ob es Orte der Begegnung oder der Aneignung sind. Solche Begriffe werden heute bewusster in den Vordergrund gerückt. Wir denken solche soziologischen Aspekte schon immer mit.
Und das zweite, bezüglich dem ich mit Rossi übereinstimme, ist, dass es nichts Neues gibt. Es gibt nur zeitgemässe Interpretationen verschiedenster Phänomene. Und solange der Mensch nicht durch Roboter ersetzt wird, hat er die immergleichen Bedürfnisse: schlafen, essen und so weiter. Daraus resultiert für mich, dass die menschliche Gesellschaft und ihre Bedürfnisse an die Städte und Architektur relativ konstant sind. Man hat zwar immer wieder mal neue Gesellschaftsformen versucht, aber diese haben nie richtig funktioniert. Wenn wir heute beispielsweise von Clusterwohnungen sprechen, dann ist das nichts Neues, sondern war in den Palästen in Venedig mit ihren Appartements bereits strukturell angelegt.

Dach Aufgang Europaallee, Zürich, 2017 | Foto © SBB CFF FFS
KK Zudem war Colin Rowe und sein Buch «Collage City» für uns wichtig. Es entstand zur selben Zeit, als Rossi in Zürich war. Er zeigte uns, wie man Versatzstücke von alt und neu zusammenbringt und durch Collagieren neue Stadträume baut. Auch das Herausarbeiten wichtiger Gebäude im Stadtraum – öffentlicher Monumente – war ein Thema.
AF Ähnlich wie Rossi sprach Rowe von starken Hierarchien in der Stadt, vom Nebeneinander von Wichtigerem und Allgemeinerem. Das ist gut und trägt bis heute. Unser Interesse an den alten Städten ist nie erloschen – im Gegenteil. Und unsere Lesart der Stadt ist ähnlich geblieben und hilft uns immer noch bei der Arbeit. Sie bewahrt einen davor, in einer allzu aktualitätsbezogenen, eher diffusen, städtebaulichen Betrachtung zu versanden, wie ich sie heute ab und zu spüre.
Für Rossi und Rowe war wie angesprochen das Arbeiten mit Referenzen ein wichtiges Thema. Auch für Eure Arbeit ist es zentral. Lasst uns in dieses Thema eintauchen.
KK Von Anfang an haben wir versucht, das, was uns fasziniert, zusammenzuführen. Wir pflegen einen riesigen Fundus an Erinnerungen – Versatzstücke aus verschiedenen Zeiten und Städten. Wenn wir in einer bestimmten Situation bauen oder ein konkretes Problem lösen müssen, tauchen oft spontan Erinnerungen auf. Dann gilt es zu überlegen, woran man sich eigentlich genau entsinnt. Vielleicht ein Haus mit einem Vordach, die Stellung eines Bauwerkes zur Strasse, eine Eingangssituation mit einer Farbe, ein Schatten... Die Frage ist dann: Wieso erinnert man sich genau an dieses Haus oder jene Stelle? Und was hat es zu tun mit dem Neuen, das wir produzieren möchten? Oft entstehen daraus Gleichungen, aber auch Überraschungseffekte. Es geht jedoch nie darum, irgend etwas vollständig zu kopieren: Man filtert die Essenz heraus und kann diese dann übertragen. Wobei: Ab und an haben wir aber auch Freude direkte Zitate einzufügen, gedankliche Spolien. Aber das muss nicht sein.
AF Das Referenzieren macht unsere Arbeit reich. Gleichzeitig kann es aber auch eine Krux sein. Wenn man sich überlegt, was zu einem Ort passt, etwas Ähnliches macht und weiterstrickt, dann läuft man Gefahr, dass man ihn lediglich – so, wie er jetzt ist – bestätigt. Das klingt zuerst einmal nicht schlecht. Einpassung ist ja generell heute ein grosses Thema. Ob das aber der richtige Weg ist, hängt stark davon ab, ob der bestehende Ort Qualitäten hat, an die man anknüpfen kann, oder nicht.
Bei der Siedlung Guggach II (2020) in Zürich haben wir uns beispielsweise angelehnt an das, was die Kollegen schon vorgespurt haben. EMI hatten bei der Siedlung Guggach I einen grossmasstäblichen Hof gemacht. Auch unser Projekt organisiert sich um einen gemeinschaftlichen Freiraum. Er ist damit also nichts Neues.
Oft muss man aber – um einem Ort eine neue Dimension zu geben – etwas Ortsfremdes einpflanzen. Eine Referenz, die nicht zum Ort passt, die zwar nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist, aber dort nicht vorkommt und damit eine neue Dimension eröffnet. Zum Beispiel die Siedlung Klee in Zürich-Affoltern (2011): Wenn man sich nur gefragt hätte, was dort hinpasst, wäre man nie auf die Idee gekommen, einen grossen Hof zu machen. Er ist fremd. Aber genau das ist es, was den Ort zum Positiven verändert hat – eine Alleinstellung. Ringsherum – obwohl das alles neu entwickelt wurde – wurde es nicht so gemacht.
Noch stärker ist das bei der Siedlung Vogelsang in Winterthur (2022). Sie ist eine völlig fremde Typologie oder Morphologie gemessen an dem, was dort an Bebauung üblich ist. Dieses Konzentrierte hat etwas Kleinstädtisches, Altstädtisches oder Dörfliches. Das hat den Ort jedoch positiv verändert. So ist eine Siedlung entstanden, die eben nicht die Anonymität der Vorstadt hat.
Das Thema der Höfe möchte ich vertiefen. Wenn Ihr Siedlungen baut, beschäftigt Ihr Euch intensiv damit, welche halböffentlichen Bereiche diese anbieten und wie diese mit dem öffentlichen Raum verzahnt sind. Dabei scheint Euch ein Austarieren von Grosszügigkeit und Intimität ebenfalls wichtig zu sein. Ist an diesen Punkten das Interesse am soziologischen Diskurs aus dem Studium noch immer lebendig?
KK Unter Soziologie verstehe ich weniger Texte zu lesen und Theorien über das Zusammenleben zu horten – auch wenn ich zum Beispiel Sokrates, die antiken Philosophen und Dramen sehr schätze. Das Spannendste ist, Leute – das «Leben» halt – mitfühlend zu beobachten.
AF Wir haben uns immer für die Gemeinschaft beziehungsweise für das Leben an sich interessiert. Der Versuch dazu möglichst viel anzubieten, zieht sich implizit durch alle unsere Projekte. Wir kehren das wie bereits gesagt nicht in den Vordergrund, aber es ist immer da, wenn wir über Form diskutieren. Nehmen wir beispielsweise den Hof der Siedlung Klee. Ein Hof sollte das Umfeld nicht ausblenden oder ausschliessen. Wenn wir dort einfach einen rechteckigen Hof gemacht hätten, mit der Idee einer Autonomie der Form, die sich nur auf sich selbst bezieht, wäre das nicht so gut geworden. Stattdessen haben wir den Hof deformiert und Einbuchtungen gemacht, die so etwas wie Halbhöfe etablieren, die auch nach aussen Anknüpfungspunkte bieten und ihn so mit der Umgebung verschränken.
Auch die Guggach-Siedlung hat Halbhöfe, die mit Tentakeln nach aussen greifen und dort Höfe andeuten. Die Vogelsang-Siedlung macht das auch. Sie hat im Grundriss R-förmige Arme, die sich in verschiedene Richtungen strecken – wie Saugnäpfe, die sich in der Umgebung verankern und so mit dem Umraum verschränken und die Siedlung zugleich öffnen.

Siedlung Guggach II, Zürich, 2020 | Foto: Seraina Wirz
KK Bei Vogelsang ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Siedlung zwei unterschiedliche Seiten hat. Vorne liegt eine Bahnstrecke und eine Strasse. Daher zeigt sie sich dort als ein zusammenhängender Bau mit einer modellierten Fassade, die – obwohl rhythmisch stark gegliedert – durch kleine vortretende dreigeschossige Hausteile eher als lineare starke Form erlebt wird. Nach hinten zu den Schrebergärten hat die Siedlung hingegen kleinmassstäbliche Teile, ins Grüne greifende Arme, die maximal dreigeschossig sind und wie Einfamilienhäuser wirken. Dieses Spiel mit dem Massstab ist etwas Tolles und macht Spass.
Das Spezielle von all den Wohnungen in unseren Projekten kommt aus der jeweiligen Situation, aus dem Städtebau. Darum sind sie nie gleich. Der Aussenraum bestimmt die Qualität der Wohnungen. Das Quartier und die Umgebung prägen sie im Innern und nach aussen deren private Aussenräume – Garten, Balkone, Loggien und so weiter. Und diese haben wiederum Einfluss auf die öffentlichen Bereiche. Ohne sie kann kein gemeinsamer Aussenraum funktionieren. Wenn eine Wohnung keinen guten privaten Aussenraum hat, funktioniert auch der Gemeinschaftsraum nicht.
Gibt es ein Projekt, an dem man das gut aufzeigen kann?
KK Wir fragen uns immer: Warum will man an einen Ort ziehen, zum Beispiel in den Klee, raus nach Affoltern? Abgesehen vom dreiteiligen Hof, was ist das Spezielle für die Wohnungen? Daher waren wir überzeugt, dass es zum Beispiel sehr gute private Aussenräume geben muss, die den schönen Hof nicht stören. Sie sind das A und O. Zwei Wohngeschosse bilden ein Sandwich. Sie teilen sich jeweils einen zweigeschossigen, eingezogenen Aussenraum. Diese gehören zu den unteren Wohnungen. Die oberen haben daneben jeweils einen grossen auskragenden Balkon, ohne dass die unteren gestört werden. Je nach Lage zur Sonne orientieren sich diese zweigeschossigen Loggias an den Hof oder nach aussen ins Quartier. Das prägt die Wohnräume dahinter und führt zu einem tiefen Grundriss.
AF Das hat uns dann zur Überlegung geführt: Kann man die Organisation einer Wohnung oder eines Hauses umdrehen? Der private Aussenraum ist meist ein Anhängsel, ein Zusatz, ausgestülpt oder halb eingezogen. Kann man das zu einem Hauptthema machen? Das führt zu einem anderen Aussenraum. Das wird künftig noch bedeutender im Rahmen der Klimaveränderung sein. Denn der Aufenthalt draussen wird etwas Wichtiges, vielleicht sogar Entscheidendes, das den Charakter der gesamten Wohnkonzeption prägt. Beim Privathaus, das Kaschka in Uesslingen gebaut hat, ist die Loggia ein wichtiges Thema. Sie prägt das ganze Haus. Sie ist eigentlich das Haus.
KK Hornbach hat nach aussen stehende Balkontürme, die nach innen Erker bilden und die verglast sind, wie in den Häusern aus dem 19. Jahrhundert im Quartier. Deren Drehung beeinflusst innen die ganzen Wohnungen. Die Verglasung ist ein Schutz gegen den Lärm der Seefeldstrasse. Und zugleich ein Erkennungselement nach aussen. Und im Innern wirkt sich die Verdrehung der Aussenräume auf die Form der Hallen und Zimmer aus. Dass das Aussen Impulse gibt für die Räume, die dahinter sind in der Wohnung, ist bei allen unseren Siedlungen so, auch bei Guggach.

Siedlung Vogelsang, Winterthur, 2022 | Foto: Andrea Helbling
Was unweigerlich bei Euren Arbeiten auffällt, ist ein Mut zum grossen Massstab.
AF Wir werden oft kritisiert für den grossen Massstab und auch den starken Ausdruck. Das hängt damit zusammen, dass wir die klassische europäische Stadt mögen: Mailand, Wien, St. Petersburg, Venedig. Paris und Turin – aber auch Bern mit den Lauben finden wir toll.
KK Die grosse Form und markante räumliche Situationen sollen helfen, dass der Ort einprägsam ist und die Bewohner*innen sich mit ihrem Quartier identifizieren können. Sie sollen sagen: «Da wohne ich, da gehöre ich hin.» Es sind Orte, an denen man sich gemeinsam findet.
Grossfiguren waren in den 1960er- und 1970er-Jahren sehr beliebt. Sie wurden jedoch dafür kritisiert, dass sie zu anonym waren. Eine Wohnung war wie die andere, meist ohne Hierarchien, ohne Alleinstellungsmerkmale. Ihr hingegen differenziert im kleinen, menschlichen Massstab ganz bewusst aus, macht jede Einheit zu einer Adresse, gebt ihr orginäre Eigenschaften – mit Nischen, Loggias, Erkern und so weiter.
AF Wenn ein Gebäude tausende von Fenstern hat und alle sind gleich, standardisiert, dann sind sie nicht als einzelne Orte identifizierbar. Um dem entgegenzuwirken, können starke Hierarchien helfen. Es gibt grossartige Beispiele aus der Geschichte dazu – Ensembles wie der Marxhof in Wien beispielsweise. Er ist zwar gross, hat aber viele markante Orte, an denen man sich orientieren kann: Risalite, Türme, Bögen und so weiter. Oder in St. Petersburg: Dort gibt es riesige Bauten mit enorm grossen Portiken, wo man den Ausdruck auf die Spitze getrieben hat, indem zwölf Säulen davorgesetzt wurden statt sechs.
Wir versuchen das auch. Die Siedlung Klee hat zum Beispiel eine Kolossalordnung in der Fassade. Der grosse Massstab von durchschnittlich sieben Geschossen wird optisch durch ein Zusammenfassen von jeweils zwei der Etagen heruntergebrochen auf nur noch drei plus Sockelgeschoss. Oder wir versuchen in der Abwicklung Orte zu schaffen, die spezifisch sind, andere Ordnungen haben, die irgendwie hervorstechen. Die Hornbach-Siedlung ist dafür ein gutes Beispiel.
KK Was man problematisch an den Grossformen der 1960er-Jahren fand, beispielsweise an den Bauten von Corbusier, war, dass es Einzelobjekte waren. Ein Kollege nennt sie immer «Pokale». Das ist ein gutes Bild für diese riesigen Gebäude, Hochhäuser oder Zeilen, die nebeneinanderstehen, ab und an zwar ein Geviert, aber darüber hinaus keinen gefassten Raum bilden. Ich denke spontan an die Robin Hood Gardens der Smithons in London (1972), die man mittlerweile abgerissen hat. Ein schönes Gebäude, mit tollen Wohnungen und Details. Aber es war ein Objekt, das sich nicht mit der Umgebung verbunden hat. Damit diese grossen Volumen der Moderne Zwischenräume bilden, ist eine grosse Anzahl nötig, beispielsweise wie in New York oder Chicago. Wir versuchen es zu vermeiden, Pokale zu machen. Wir wollen, dass unsere Gebäude in Beziehung stehen zu ihrer Umgebung und den Raum fassen; dass Zwischenräume entstehen, die wie magnetisch wirken. Wie bei Frohburg: Da sind die Gebäude wie Klammern, die sich gegenüberstehen, sich anschauen und aufeinander beziehen und wieder öffnen – wie zum Beispiel Crescents – grosse landschaftliche Räume. So werden mehrere Gebäude zu einem – wenn auch mit Luft dazwischen. Das ist eine andere Art von Raumfassung.
AF Die Tendenz der Moderne war natürlich eine andere. Sie war objektbezogen und hat diese in freien Ensembles zueinander gestellt. Genau das machen wir nicht. Da sind wir Klassiker. Wir suchen Korrespondenz. Das Gegenüberstellen muss passen. Man muss ja spüren, dass ein Raum geschaffen werden soll – und dies kann nicht irgendwie geschehen.

Wohnhaus Lokomotive, Winterthur, 2006 | Foto: Michael Lio
Ihr habt vorhin noch das Stichwort «Ausdruck» gegeben.
AF Ausdruck wagen wir, weil wir der Meinung sind, es braucht ein Minimum, damit man etwas spürt. Wenn man alles nur in Richtung kleinster Andeutung entwickelt, bleibt vieles verschwiegen. Viele finden das Neutrale zwar richtig, weil sie meinen, nur dann können die Betrachtenden eigene Assoziationen und Gefühle entwickeln. Wir denken hingegen, dass man animiert werden muss. Dazu ist ein gewisser Ausdruck nötig und der muss deutlich sein. Das ist wie im Theater. Es müssen Auslöser für Emotionen da sein.
KK Und auf der Ebene vom Detail versuchen wir eine gewisse Vielfalt zu schaffen. Aber die Unterschiede müssen nicht so auffällig sein. Es ist super, wenn jemand nach zehn Jahren entdeckt, dass ein Fenster ein bisschen von den anderen abweicht, eine Ecke leicht anders ist oder ein Balkon leicht abgedreht… Das sind also sehr leise Massnahmen. Aber sie sind sehr wichtig für den Massstab, da sie entscheidend darüber sind, wie sich die Bewohner*innen in einem grossen Hof oder Gebäude wahrnehmen. Wo fühlt man sich kräftig, gross und angenommen? Und wo das Gegenteil? Wo ist es abweisend, kalt und formal? Serlio hat für die Komödie, die Tragödie und die Landschaft Städtebilder entworfen. An bestimmten Stellen der Stadt ist das Formelle, dass man sich neutraler fühlt, wichtig und an anderen eher das Verspielte, wo man sich näher fühlt. Das sind Kulissen oder Szenerie, wie Axel es am Anfang genannt hat.

Wohnhaus Lokomotive, Winterthur, 2006 | Foto: Walter Mair
Könnt Ihr etwas über die Art und Weise sagen, wie Ihr mit Materialien umgeht?
KK Viele Kolleg*innen glauben, möglichst viel wegzulassen, auch damit es billig ist, sei ein guter Weg. Da versuchen wir im Gegensatz ein Mehr zu bieten. Ab und an ist ein bisschen Kitsch und Humor gut - nicht immer dieses Bierernste. Man kann im Inneren auch mit billigen Materialien relativ gut komponieren. Es muss nicht immer Teakholz oder ein teurer Stein sein. Axel nennt das immer das «Gleichgewicht des Schreckens». Am Rigiplatz, wo wir selbst in einem der beiden Genossenschaftshäuser wohnen (2010), mussten wir schauen, dass sie günstig werden. Da haben wir fleischkäsefarbenen, gemusterten Stein verwendet. Der kommt billig als Schiffsbeschwerung aus Brasilien oder irgendwo aus dem globalen Süden. Und es gibt Kunstharz, das Holz imitiert – hier ist es amerikanische Kirsche, irgendein Feinsteinzeugboden, aber spannend verlegt und ein paar Spiegel. Für die jüngeren Baukommissionsmitglieder war das fast ein Sakrileg und wir mussten sie zuerst überzeugen. Aber es ergab eine super Kombination. Man hat das Gefühl, die Gebäude waren schon immer irgendwie da.
AF Das ist ein Beispiel dafür, wie wir subversiv mit Materialien umgehen. Insbesondre bei Genossenschaftsbauten ist man unter starkem Kostendruck. Nur so kann man überraschende Kombinationen machen.
Lasst uns eintauchen in die Grundrisse und vor allem die Schnitte Eurer Wohnungen. Ihr habt häufig eineinhalb- oder doppelgeschossige Räume vorgeschlagen beziehungsweise auch umsetzen können.
AF Differenzierung in den Höhen fasziniert jede Architekt*in. Das kennt man von Le Corbusier und seiner Idee der Immeuble Villa, einer repräsentablen Haus-Einheit innerhalb des grossen Ganzen. Dort sind es dann natürlich zweigeschossige Volumen. Wir sind im Studium zudem auf Moissei Ginsburg gestossen – eine weitere Ikone für uns. Sein Narkomfin-Kommunehaus (1930) in Moskau war bereits ein Vorbild für Le Corbusiers Unité d’Habitation. Im Narkomfin gibt es jedoch «nur» 1,5 Geschosse hohe Räume. Da kommt zwangsläufig etwas Raumplanartiges ins Spiel, wo man mit versetzten Einheiten arbeitet, also eine Art Geschosssplit hat. Das ergibt Raumhöhen von 3,8 bis 4 Metern, die sehr interessant sind für räumliche Grosszügigkeit trotz verdichtetem Wohnen. Das haben wir mehrfach versucht umzusetzen im Wohnungsbau. Die Chancen, die man damit bei Wettbewerben hat, sind natürlich sehr überschaubar, denn hohe Räume sind schwer vereinbar mit unseren Anforderungen an Wirtschaftlichkeit im Wohnungsbau.
Ihr spielt auch in den Wohnungen gerne mit der Parallelität von grossem und kleinen Massstab.
AF Genau, und wir nutzen verschiedene Gestaltungsmittel, um das noch zu betonen. Das 1,5-geschossige Wohnzimmer beim Wohnhaus Wiesenstrasse in Winterthur (2005) hat beispielsweise einen Kamin, der nicht einfach ein kleines Loch in der Wand ist, sondern ein plastischer Körper in der Ecke, der sich über die gesamte Höhe streckt und diese damit überhaupt erst zum Ausdruck bringt. Das hat etwas Monumentales. Das Vorbild war ein venezianischer Palast. Das hat den Räumen plötzlich eine Art Noblesse gegeben. Das führe ich auch deshalb an, weil es sowohl in der Stadt als auch in der Wohnung immer etwas braucht, das einen ein bisschen aus dem Alltag herausreisst. Ein wenig Aussergewöhnlichkeit oder Luxus, oder vielleicht sagen wir besser Sonntagsgefühl.
Wir wollten aber auch für Genossenschaften solche Wohnungen machen und da ist es einfach schwierig zu mit diesem Spiel im Schnitt mit verschiedenen Geschosshöhen und verspringenden Ebenen wegen der geforderten Barrierefreiheit. Da muss man auf andere Dinge setzen, die Wohnungen in der Ebene planen und überlegen, was man ihnen geben kann, damit sie mehr als nur ein Funktionsschema sind.
Alberti hat ja behauptet: Die Stadt ist ein Haus und das Haus ist eine Stadt. Und das kann man direkt anwenden. Wir denken, dass eine Wohnung in ihrer Struktur Hierarchie braucht wie eine Stadt, mit öffentlicheren und privateren Räumen, gewaltigere Sachen, normalere Sachen, Plätze und Strassen. Und das ist etwas, das man auch einer Genossenschaftswohnung geben kann: eine wahrnehmbar hierarchische Ordnung und eine städtische Kraft.

Wohnhäuser Rigiplatz, Zürich, 2010 | Foto: Walter Mair
Im Moment dominiert der CO2-Ausstoss durch Architektur – beim Abbau von Rohstoffen, der Produktion von Bauteilen, der Konstruktion, dem Unterhalt bis zum Abriss und der Entsorgung – den Diskurs. Hat das Euren Umgang mit Material verändert?
AF Wir sprechen immer wieder über Nachhaltigkeit. Man kommt nicht dran vorbei. Aber wir sind überzeugt, dass dies nicht bloss eine Rechenübung sein darf. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, alles in Frage zu stellen, und auch nicht daran, dass die Dringlichkeit etwas grundlegend anderes hervorbringen wird. Einige Kolleg*innen haben bereits in den 1960er-Jahren gesagt: «Jetzt wird sich die Architektur revolutionär verändern», und meinten damit vielleicht technoid-intelligente Fassaden. Jetzt sagen die Kolleg*innen wieder: «Über die Klimadebatte sieht man alles anders. Die Architektur ist neu geboren.» Das Bauen hat sich dennoch nicht furchtbar verändert und wird es wohl auch jetzt nicht. Wir denken, dass Dauerhaftigkeit in der Diskussion stärker gewichtet werden muss. Diese Rechnerei ist irgendwo absurd. Am Schluss ist uns das Naheliegende lieber, die Tradition und das, was seit tausenden Jahren bewährt ist.
Warum wir wissen, wie der etruskische Tempel ausgesehen hat? Der war aus Holz gebaut. Aber er war zum Schutz komplett verkleidet mit Terrakottaplatten. Jeder Balken und der Giebel hatten als Abschluss Platten aus gebranntem Ton oder Backstein. Das Holz ist über die Jahrhunderte oder Jahrtausende verschwunden. Aber die Terrakottaplatten sind geblieben. Es ist also nicht die Struktur, sondern die Hülle, deretwegen wir wissen, wie der Tempel ausgesehen hat. Was ich damit sagen will: Wir sollten Gebäude nicht für 50 Jahre entwerfen, sondern am besten für die Ewigkeit.Kalk und Backstein sind Materialien, die seit 5000 Jahren verbaut werden und sie haben eine lange Haltbarkeit. Was wollen wir da über Nachhaltigkeit reden? Wir können über Beton diskutieren, weil der wirklich aufwendig produziert wird. Aber das bisschen Feuer, das man für Kalk und Backstein braucht… Und Holz ist schon okay. Aber wir können nicht alle Gebäude aus Holz machen, dann gehen irgendwann unsere Wälder zur Neige. Und wo sind unsere Sägereien geblieben, die das Holz verarbeiten? Sollen wir es vom Bregenzer Wald oder aus Polen und Tschechien herholen, wo heute noch die Sägereien sind, und dies mit 40 Tonner-LKWs?
KK Ist es letztlich nicht am nachhaltigsten, wenn die Leute ein Gebäude gerne haben? Wenn die Wohnungen geliebt werden? Wenn sie günstig sind und man sie sich leisten kann? Wichtig ist, dass man sich mit dem Ort, an dem man wohnt, identifizieren kann. Dass ein Gebäude nicht beliebig ist und überall stehen könnte. Dass man das Gefühl hat, ich lebe in der Stadt, in dem Quartier und in dem Haus. Und alle anderen, die auch da wohnen, kenne ich und sie identifizieren sich ebenfalls mit diesem Gebäude.
Wir wollen den Lifetime Achievement Award nicht als Schlussstein in Eurem Werk verstehen, sondern spüren, wozu Ihr in den nächsten Monaten und Jahren Lust habt.
KK Aktuell arbeiten wir an Mehrgenerationenhäusern mit sehr vielen Clusterwohnungen, wo verschiedene Arten zu wohnen drin möglich sind. In Hornbach gibt es ja bereits zwei Clusterwohnungen über drei Etagen. Die sind wie kleine Paläste in Venedig, mit gemeinsamen grossen Räumen.
Gibt es bestimmte Orte, die Euch besonders interessieren?
KK Was reizt, wäre eine Siedlung am Stadtrand, am Übergang zum Landschaftsraum. Wir haben gerade einen Wettbewerb an einer solchen Situation verloren. Wir denken, dass man für die Dörfer und Gemeinden im Umland der grossen Städte Lösungen finden sollte. Viele sind derzeit von Zersiedelung bedroht. Man baut da meistens eine Agglo auf. Die Stadt frisst sich in die Landschaft, indem man neue grossmassstäbliche Quartiere anlegt. Und in den Dörfern werden riesige Wohnhäuser gebaut, die wie aufgeblasene Einzelkörper wirken. Wir denken, dass es nicht richtig ist, dort im selben Massstab und die gleichen Wohnungstypen zu bauen wie in der Stadt. Sie müssen mit dem Land zu tun haben. Zudem denken wir, dass man spezielle Übergangsformen zwischen Siedlungsraum und Landschaft schaffen sollte. Wir würden gerne dort ein Statement machen.

Einfamilienhaus Uesslingen, Zürich, 2024 | Foto: Peter Knupp
Was wäre ein alternativer Weg?
KK Es warten noch einige Projekte, die wir schon vor längerer Zeit gewonnen haben, auf eine Weiterentwicklung, die sich mit dem «ländlichen», landschaftlichen Kontext beschäftigen. Bei beiden ist die Gründung eines eigenständigen Quartiers und Ortes unser zentrales Anliegen – städtisch oder ländlich. Wie wohnt man auf dem Land beispielsweise ohne Einfamilienhaus?
AF Aber uns interessieren auch knifflige Aufgaben. An der Siedlung Frohburg arbeiten wir mit Miroslav Šik bereits länger. Da beschäftigt uns die Frage: Wie baut man eine Gartenstadt wie Zürich-Schwammendingen um? Was passiert mit ihr, wenn sie plötzlich einen anderen Massstab bekommt mit sieben oder acht Geschossen? Wie verändert das den Aussenraum? Kann das noch immer eine Gartenstadt sein oder wird das schlicht zur Agglomeration. Wir fänden es schade, wenn sie den durchgrünten Charakter verlieren würde oder einer beliebigen Ensemblebebauung Platz machen würde.
Wie man gut auf den Ort reagiert, beschäftigt uns auch bei einem anderen Projekt in St. Gallen, an dem wir jetzt dran sind. Dort haben wir für einen städtischen Block am Rand der Stadt einen Wettbewerb gewonnen. Wir haben ja viel in Zürich gebaut. Wir gehen es dort aber anders an, denn St. Gallen hat einen leicht anderen Charakter, auch wenn das kaum spürbar ist. Es hat etwas Bergigeres, Östlicheres. Das zu fassen und irgendwo in der Architektur empfindbar zu machen, interessiert uns.
Würdet Ihr im Rückblick das ein oder andere anders machen?
AF Wir sind mit unserem Werk sehr zufrieden. Es hat uns auf unterhaltsame Art und Weise begleitet. Wir finden uns darin wieder. Es spricht mit uns.
Was ist Euch für die Zukunft – bezogen auf die Architektur – am wichtigsten?
KK Eine Prise Humor weiterhin und ein bisschen Glanz und Gloria.
Der Text wurde in Swiss Arc Award Mag 2025–6 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.
Die Laudatio von Remo Derungs können Sie als PDF herunterladen.