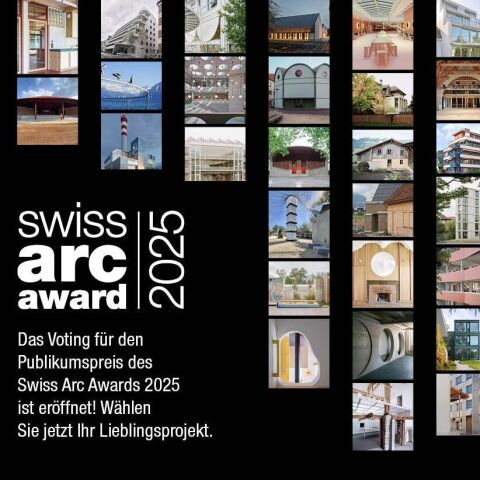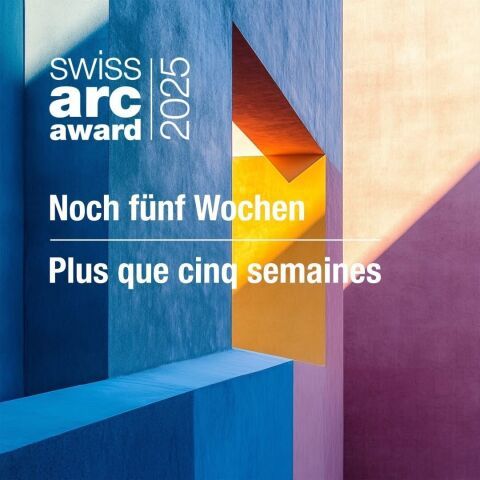Zwischen Dichte und Durchlässigkeit – die Arc Award Jury 2025 im Interview

Im Rahmen der Juryreise erläuterten die jeweiligen Architekt*innen ihre Projekte. Lukas Baumann eröffnete den zweiten Tag mit einer Führung durch das instandgesetzte Haus Halse in Steinen. | Foto: Jørg Himmelreich
Jørg Himmelreich – Was war Dein persönliches Highlight unter den 18 Gebäuden, die Ihr im Rahmen der diesjährigen Juryreise besucht habt?
Remo Derungs Aus meiner Sicht gab es mehrere Highlights. Das Projekt Hortus in Allschwil bei Basel von Herzog & de Meuron sticht jedoch durch seine radikale Haltung heraus. Ich denke, dieses Projekt wird «als Leuchtturm der Nachhaltigkeit» ein Vorbild sein für viele Kolleg*innen – und ebenso hoffentlich auch für Bauherrschaften.

Daniel Niggli zeigte das Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse in Zürich, in dem EM2N seit der Fertigstellung ihr Büro betreiben. | Foto: Jørg Himmelreich
Die Suche nach einer möglichst nachhaltigen Architektur prägt erneut einige der eingegebenen Projekte und war auch bei den Diskussionen in der Jury wieder zentral. Dass Ihr das Hortus von Herzog & de Meuron in Allschwil ausgezeichnet habt, haben wir in der Redaktion daher antizipiert, da es versucht, gleich an allen vorhandenen Stellschrauben zu drehen. Welche anderen spannenden Projekte und Ansätze habt Ihr entdeckt?
Roger Boltshauser Es gibt verschiedene Ansätze, nachhaltig Architektur zu machen: Beispielsweise die «5 R» von Philipp Entner und Daniel Stockhammer: «Refuse» heisst, Gebäude zu unterhalten und nicht abzureissen. «Reduce» meint Um- und Weiterbau oder Nachverdichten. «Re-use» heisst Bauteile wiederzuverwenden. «Recycle» beinhaltet Baustofftrennung und Wieder- oder Weiterverwertung; und mit «Rot» sind Materialien gemeint, die schadstofffrei entsorgt werden können, wie beispielsweise Stroh. Neu bauen mit CO2-armen Materialien ist also nur ein Teil dessen, was wir tun können. Viele Beiträge haben sich mit dem Thema des Um- und Weiterbauens befasst, wie zum Beispiel der feine Umbau von Andreas Fuhrimann und Gabrielle Hächler. Sie haben die Fassade kaum angerührt, im Inneren aber eine kleine Trouvaille erschaffen und dabei den Charme des kleinen Hauses sensibel weiterentwickelt.
Mit der Guggach-Siedlung habt Ihr einen Wohnungsbau ausgezeichnet, bei dem clevere, kompakte Grundrisse im Zentrum stehen. Beobachtet Ihr generell eine Tendenz hin zu kleineren Wohnungsgrundrissen?
Dominique Salathé Unbedingt! Endlich ist angekommen, dass weniger mehr ist. Kleine, räumlich geschickt organisierte Grundrisse entsprechen der Nachfrage und bilden die aktuellen Lebensformen besser ab. Es geht darum, möglichst sparsam mit individuellem Wohnraum umzugehen, um im Gegenzug grosszügigen gemeinschaftlich genutzten Raum zu ermöglichen.

Mark Bähr von Herzog & de Meuron führte durch das neue Universitäts-Kinderspital Zürich. | Foto: Jørg Himmelreich
Angesichts zunehmender Verdichtung in den Städten lässt sich bei einigen Architekt*innen eine Suche nach poröser Architektur beobachten – sichtbar etwa in der Guggach-Schule, der gleichnamigen Siedlung, dem Kinderspital Zürich oder dem EM2N-Gewerbebau in Zürich-Binz. Wie kann Architektur einladend und durchlässig sein?
Ludovica Molo In einem zunehmend dichten urbanen Kontext ist die Architektur nicht nur dazu aufgerufen, den Raum zu optimieren, sondern auch Offenheit, Flexibilität und Einladung zu schaffen. Heute werden Stadtviertel multifunktional – und ebenso die Gebäude. Eine Schule zum Beispiel kann sich für das Viertel öffnen und über die reine Unterrichtszeit hinaus genutzt werden. Eine poröse Architektur zu entwerfen, bedeutet offene Erdgeschosse, eine stärkere Integration von Innen- und Aussenbereichen sowie «andere» Räume – sogenannte Extraspaces – zu planen, die sich einer eindeutigen Funktion entziehen. Gebäude wandeln sich im Laufe der Zeit, passen sich unterschiedlichen Nutzungen und Nutzenden an und bieten bewusst «offene» Räume zur Interpretation, die wie Schwämme das urbane Leben aufnehmen und neue Nutzungs- und Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Diese Porosität ermöglicht es, mehrere Funktionen in einem einzigen Baukörper zu bündeln, Menschen näher zusammenzubringen und neue Formen des Zusammenlebens zu fördern.Vielleicht liegt genau in diesem undefinierten Raum zwischen Geplantem und Potenzial eine bedeutende architektonische Experimentierphase. Eine Forschung, die über die Funktion hinausgeht und räumliche Modelle sucht, die auf den aktuellen ökologischen und sozialen Wandel reagieren können. Die Herausforderung besteht darin, Räume zu gestalten, die sich nicht abschliessen, sondern sich gemeinsam mit ihren Bewohnern verändern. Gleichzeitig bedeutet dies, den Blick nicht nur auf das Innenleben der Gebäude zu richten, sondern auch auf deren Umfeld. So wird nicht nur die Gebäudehülle durchlässiger, sondern auch der öffentliche Raum – die Zonen zwischen den Gebäuden – wird zum zentralen Bestandteil des Entwurfs, zur eigentlichen Seele des kollektiven Lebens, die bis in die Gebäude hineinwirkt.
Infrastrukturbauten bilden aktuell wieder eine wachsende Bauaufgabe – wohl auch deshalb, weil viele Gebäude der Nachkriegszeit saniert werden müssen oder Energieinfrastrukturen an neue Technologien angepasst werden. Ist das eine Aufgabe für die Architektur?
DS Die Frage nach der Erneuerung und Anpassung unserer Infrastruktur stellt sich zunehmend mit Nachdruck. Die spürbare Dringlichkeit, auf klimatische Veränderungen zu reagieren, ebenso wie das kontinuierliche Bevölkerungswachstum bringen neue Herausforderungen mit sich. In der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen entstehen dabei nicht nur innovative Lösungsansätze, sondern auch spannende Handlungsfelder für uns Architekt*innen – Bereiche, die in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund geraten sind.

Pablo Donet von DOSCRE führte durch die vielfältigen Wohnungen in der Wohn- und Gewerbesiedlung Guggach in Zürich. | Foto: Jørg Himmelreich
Spürt Ihr, dass bei Politiker*innen, Behörden, Bauherrschaften und Architekt*innen endlich ein Bewusstsein für die Biodiversitätskrise entsteht? Oder handelt es sich beim von Euch ausgezeichneten Projekt Kreis der Vögel in Lausanne um eine Ausnahme, die Ihr prämiert habt, um dem Thema mehr Gewicht zu verleihen?
LM Das Projekt Kreis der Vögel stellt eine einzigartige und ortsspezifische Antwort für Lausanne dar. Dennoch ist das Thema Biodiversität – und unser Zusammenleben mit anderen Arten – heute in der öffentlichen und politischen Diskussion wesentlich präsenter als früher. Es scheint, als würden wir ein Bewusstsein wiederentdecken, das in der Moderne verloren gegangen ist, als die Natur oft nur als Ressource betrachtet wurde.Trotz dieses zunehmenden Interesses ist es wichtig, daran zu erinnern, dass der Schutz der Biodiversität ständige Wachsamkeit und Engagement erfordert, die allzu oft vernachlässigt oder heruntergespielt werden. In den letzten Jahren hat die globale Biodiversitätskrise dazu geführt, über ein harmonisches Zusammenleben mit den Ökosystemen nachzudenken. Immer häufiger versucht die Architektur, Räume zu schaffen, die auch für andere Arten geeignet sind, und überdenkt dabei die Wohnparadigmen, um ein respektvolleres Miteinander zu fördern. Darüber hinaus treten diese Eingriffe in einen dynamischen Dialog mit der Landschaft und der Zeit, indem sie anerkennen, dass die Natur sich ständig wandelt. Dieser Ansatz eröffnet eine neue Sichtweise der Architektur als Brücke zwischen Mensch und Umwelt, um ein nachhaltiges und dauerhaftes Gleichgewicht anzustreben.
In diesem Jahr wird beim Arc Award erstmals ein Preis in der Kategorie Innenarchitektur vergeben. Was ist Dein Eindruck von den eingereichten Projekten? Welche Themen stehen derzeit im Zentrum der Auseinandersetzung in der Innenarchitektur – und welche Einreichungen stechen für Dich besonders hervor?
RD Diese Kategorie hebt sich sicherlich in ihrer Massstäblichkeit von den klassischen Kategorien ab. Die Disziplin der Innenarchitektur versteht sich im Dialog mit der Architektur. Insofern sind für uns vor allem die Projekte und Einreichungen hervorgestochen, welche genau diese Symbiose eingehen oder suchen. Oft ist es die sorgfältige Kombination und das Zusammenspiel kleinster Details, welche die Raumatmosphäre qualitativ prägen.

Christian Weyell und Kai Zipse machten anschaulich, wie der Park in das Schulgebäude Guggach in Zürich hineinfliesst. | Foto: Jørg Himmelreich
Auch wenn bei den Preisen erneut vor allem die alten Hasen das Rennen gemacht haben: In diesem Jahr wurden zahlreiche spannende Projekte junger Büros eingereicht – einige davon haben es auf die Shortlist geschafft. Welche Konzepte verfolgen diese jüngeren Teams?
RB Immerhin hat mit Donet Schäfer Reimer Architekten ein junges Team die sehr wichtige Kategorie des Wohnungsbaus gewonnen. Sie stellen sich den aktuellen Fragen der Zeit, etwa indem sie intelligente und innovativ neue Grundrisstypologien entwickelt haben. Treppenhäuser und Erschliessung wurden bei der Guggach-Siedlung ausgelagert und sind zugleich Balkone. Sie überzeugen durch eine suffiziente Strategie und eine mutige Fassade aus PV-Elementen. Virtuos und gezielt wurden zudem Farben und Gestaltungselemente eingesetzt. Was entsteht, ist eine spannende und ausdrucksstarke Architektur, die als Ausdruck der Anliegen und der Konzepte ihrer Generation gelesen werden kann.

Reto Gasser führte durch das Schulhaus Allmend in Zürich. | Foto: Jørg Himmelreich
Welche inhaltlichen Schwerpunkte oder gestalterischen Ansätze sind Euch bei den Hochschularbeiten besonders ins Auge gestochen? Und was gab letztlich den Ausschlag für die Auszeichnung von «Hétérotopies 95200»?
DS Bei der Durchsicht der Arbeiten ist mir aufgefallen, dass sich die Hochschulen schnell auf die neuen Fragestellungen eingestellt haben. Umbau, Re-Use und ein bewusster Umgang mit Ressourcen ist an den meisten Schulen ein grosses und offensichtlich selbstverständliches Thema. Dabei wird viel experimentiert und im kleinen Massstab auch selbst gemacht. Das ist wunderbar. Manchmal geht jedoch vor lauter Experimentierfreude die Frage nach den übergeordneten räumlichen und architektonischen Qualitäten etwas vergessen. Das war auch ein Grund dafür, dass wir mit «Hétéropies 95200» eine Arbeit ausgezeichnet haben, die sich mit Typologien – mit der räumlichen Neuerfindung im Bestand im grossen Massstab – auseinandergesetzt hat. Das ist eine andere Perspektive, die unserer Meinung nach wichtig ist.
Was hat Euch gefehlt? Welche Defizite sind Euch bei den diesjährigen Einreichungen besonders aufgefallen? Und was würdet Ihr Euch für die Ausgabe 2026 wünschen; worauf hofft Ihr künftig stärker zu treffen?
RD Die Eingaben waren sowohl in der Menge wie auch in ihrer Verschiedenartigkeit sehr breit gefächert. Die verschiedenen Kategorien fördern und motivieren dies sicherlich mit. Wünschenswert wären mehr Projekteinreichungen aus den Bereichen Gastronomie oder Retail sowie Ausstellungsarchitektur und Kulturbauten wie Theater- oder Sakralbauten. Eine Innenarchitektur, die darauf reagiert, die interpretiert und sich den wandelnden und verändernden Bedürfnissen anpasst, ist eine spannende, herausfordernde Aufgabe, zu der wir gerne mehr Beispiele sehen würden.
Die Jury
Roger Boltshauser
ist Inhaber der Büros Boltshauser Architekten in Zürich sowie Boltshauser Architektur in München. Er ist Professor an der ETH Zürich und Mitglied des Baukollegiums Berlin.
Remo Derungs
ist Inhaber von gasser, derungs Innenarchitekturen in Zürich und Chur. Aktuell ist er Präsident der VSI.ASAI. und Professor an der Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana in Mendrisio. Zusammen mit Carmen Gasser Derungs führt er zudem das Gelbe Haus in Flims.
Ludovica Molo
ist Direktorin des Istituto Internazionale di Architettura in Lugano und Mitinhaberin des studio we in Lugano. Von 2016 bis 2024 stand sie als Präsidentin dem Bund Schweizer Architekten BSA vor.
Dominique Salathé
ist Inhaber des Architekturbüros Salathé Architekten in Basel. Seit 2004 ist er Professor am Institut Architektur an der FHNW und unterrichtete als Gastdozent an der ETH Lausanne.
Der Text wurde in Swiss Arc Award Mag 2025–6 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.