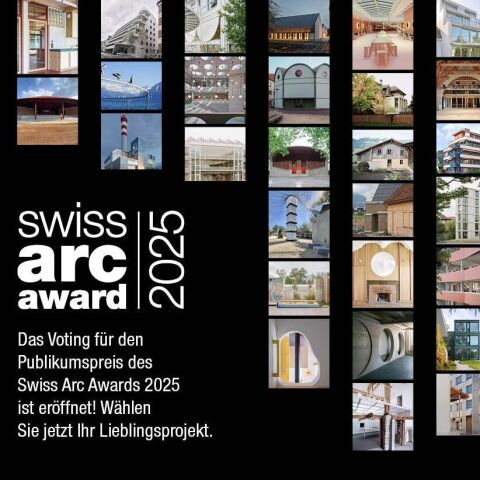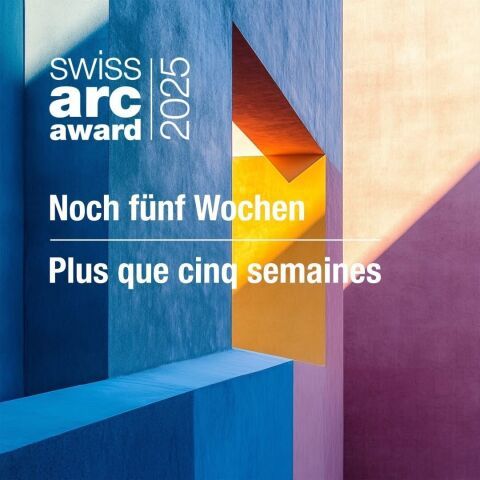Sehen, anfassen, riechen, schmecken – Eindrücke der Jury von der Arc Award Reise 2024

Elisa Schreiner, Mina Faas, Pascal Flammer, Philipp Scheidegger, Manuel Herz, Roger Boltshauser und Ludovica Molo blicken auf das Hobelwerk Haus D in Winterthur. | Foto: Jørg Himmelreich
Welches Projekt war euer persönliches Highlight oder anders gefragt, was hat euch vor Ort am meisten überrascht?
Dominique Salathé Ich finde es immer unglaublich bereichernd, die Bauten vor Ort zu besichtigen. Eigentlich müssten wir uns dafür noch viel mehr Zeit nehmen. Denn erst wenn man die Räume wirklich erlebt, versteht man die Architekturen. Die eingereichten Bilder, Texte und Pläne bleiben letztlich immer nur ein Versprechen. Was mich bei dieser Juryreise besonders beeindruckt hat, war die Vielfalt. Es fällt mir darum schwer, hier ein Einzelnes herauszupicken.
Ludovica Molo Das sehe ich genauso. Die Orte, die wir besucht haben, zeugen von einer immer dichter besiedelten Schweiz, in der die Architekturschaffenden mit neuen Formen der Raumnutzung experimentieren. Sie erzählen von einem Land, das angesichts der aktuellen Herausforderungen nach einer neuen Urbanität, nach der Revitalisierung seiner Randgebiete und nach einem ressourcenschonenden Umgang mit dem Bestand sucht. Ob es sich um einen neuen Stadtteil oder um ein Atelierhaus für Mutter und Kind in alpiner Umgebung handelt: Eines der grossen Themen erscheint mir gerade das Zusammenleben zu sein, das Verhältnis von Wohnen und Arbeiten und die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Wir waren vielerorts überrascht von der schieren Fülle an Ideen und wie sie artikuliert und entwickelt werden, fast so, als gäbe es Tausende richtige Antworten. Allen gemeinsam ist der soziale Aspekt, der als Grundwert die Kultur und die Qualität des Bauens bestimmt. So scheint es mir, dass die Reise uns zu einer Vielzahl an Projekten voller Inspiration, Sorgfalt und Engagement geführt hat, die jedes für sich den Weg in die Zukunft weisen.

Ludovica Molo bei der Besichtigung der Burg Neu-Aspermont in Jenins | Foto: Mina Faas
Ludovica, du bist seit der ersten Preisverleihung dabei, hast die Entwicklung verfolgt, reflektiert und vorangetrieben. Wie haben sich deiner Meinung nach der Architekturpreis selbst und seine Schwerpunkte entwickelt?
LM In diesen zwölf Jahren hat sich alles verändert und doch nichts. 2012 wirkt in weiter Ferne und die Welt wird von Krisen heimgesucht, die sich in rasantem Tempo aneinanderreihen: von der Gesundheitskrise über die geopolitische Krise bis hin zur Energiekrise, ganz zu schweigen von der Klimakrise. Obwohl seit mehr als fünfzig Jahren davon die Rede ist, scheint sie erst jetzt wirklich im öffentlichen Bewusstsein angekommen zu sein. Unser Blick auf die Zukunft hat sich verändert und stellt viele Überzeugungen infrage. Insbesondere die Art und Weise, wie wir unseren Beruf ausüben, steht auf dem Prüfstand. Themen wie Wiederverwendung, Kreislaufwirtschaft und Sparsamkeit beherrschen den Diskurs, während sich gleichzeitig die Vorstellung davon, was wir unter guter Architektur verstehen, gewandelt hat. Das Spektrum ist viel breiter und geht über das eigentliche Gebäude hinaus, es reicht von ganzen Arealentwicklungen bis hin zu kleinen Eingriffen bei Restaurierungen. Ich empfinde uns inzwischen als offener, vielleicht auch weniger dogmatisch, was die Vielfalt der Architektursprachen betrifft. Im Vergleich zu 2012 sehe ich aber viel höhere Ansprüche an das soziale, politische und ethische Engagement, das den Projekten zugrunde liegt. Dies scheint mir im Vergleich zu früher eine unabdingbare Voraussetzung für Qualität zu sein. Manchmal stellen wir bei genauerer Betrachtung auch fest, dass sich nichts oder zu wenig geändert hat und Projekte in der Realität hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Architekturschaffende sind in der aktuellen Debatte gefordert, nicht nur Dienstleister zu sein, sondern selbst als politische und gesellschaftliche Akteure aktiv zu werden. Inwiefern gibt es Spielräume für gesellschaftliche Mehrwerte und werden diese aktiv genug eingefordert?
Manuel Herz Als Architekt*innen wissen wir, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, die über die reine Funktionserfüllung hinausgeht. Das ist keine neue Entwicklung, sondern im Grunde ein integraler Bestandteil unserer Disziplin. Inwieweit unsere Kolleg*innen sich dessen bewusst sind, ist ein wesentlicher Qualitätsfaktor. Was sich unter Umständen in den letzten Jahren geändert hat, ist die Brisanz dieser Verantwortung, insbesondere im Hinblick auf die Ressourcen. Die Tatsache, dass Gebäude von den Baustoffen über die Errichtung und den Betrieb bis hin zum Abriss oder Umbau etwa 40 Prozent der gesamten Energie und Ressourcen verbrauchen, zeigt deutlich, welch gigantischen Einfluss unser Beruf auf die Umwelt, die Gesellschaft und die ganze Welt hat. Eigentlich ist das eine wunderbare Chance, denn wir sind uns der Bedeutung unserer Arbeit bewusst. In der Schweiz, der vermutlich wohlhabendsten Demokratie der Welt, sind wir geradezu verpflichtet, diese Verantwortung wahrzunehmen und einzufordern. Das geschieht bereits. Aber es gibt Luft nach oben.

Roger Boltshauser, Stephan Buehrer, Manuel Herz, Martina Wuest, Philipp Scheidegger und Mina Faas schrauben sich die Rampen des ENO Werkhofs in Rümlang empor. | Foto: Jørg Himmelreich
Das Thema Kreislauffähigkeit klingt in vielen Favoriten an. Geht Nachhaltigkeit zulasten der gestalterischen Freiheit oder wird es in Zukunft eher Aufgabe der Architekt*innen sein, Re-Use-Elemente zu einer möglichst stimmigen Collage zusammen-zufügen?
DS Wiederverwendbarkeit ist heute eine Selbstverständlichkeit. Die Projekte in der engeren Wahl thematisieren dies auf unterschiedliche Art und Weise. Nachhaltigkeit soll und darf keinesfalls als Einschränkung der Gestaltungsfreiheit verstanden werden. Ganz im Gegenteil! Der Umgang mit dem Bestand, mit neuen Baustoffen und/oder wiederverwendeten Bauteilen eröffnet neue Möglichkeiten. Die Architektur wird dadurch reicher und differenzierter. Welche konkreten Strategien dabei erfolgversprechend sind, wird sich zeigen. Ausser Frage steht jedoch, dass wir lernen müssen, unvoreingenommen mit neuen Fragestellungen umzugehen, und versuchen sie als Chance und nicht als Einschränkung zu begreifen.
Obwohl Schweizer Städte kontinuierlich verdichtet werden, fehlt es an Wohnraum. Bietet die diesjährige Shortlist vielversprechende Lösungsansätze?
Roger Boltshauser Mich haben einige Genossenschaftsprojekte wirklich beeindruckt. Variable Wohnformen kombiniert mit funktionalen Gemeinschaftsräumen führen zu überraschenden architektonischen Antworten. Ich denke da zum Beispiel an Gemeinschaftsräume, die zur Erschliessung, als Laubengänge oder sogar Gewächshäuser angelegt sind. Als Treffpunkte für die Bewohner*innen fallen diese Räume grosszügig oder intim aus. Je nach Jahreszeit hängen die Pflanzen voll reifer Früchte, verlangen also geradezu gemeinschaftlichen Einsatz. Es ist spannend zu sehen, wie immer mehr Nutzungsverlagerungen geplant werden und so lebendige und attraktive Aufenthaltsorte entstehen.

Manuel Herz und Dominique Salathé im Wohn- und Atelierhaus Lind in Urmein | Foto: Elisa Schreiner
Neben Bauwerken in der Schweiz sind dieses Jahr auch einige internationale Projekte unter den Favoriten. Gibt es eine Öffnung der helvetischen Architektur oder einen Austausch, der über international tätige Büros und ausländische Mitarbeitende in hier ansässigen Büros hinausgeht?
MH Dass Schweizer Architekturbüros international tätig sind, ist keine neue Entwicklung. Denken wir nur an Hannes Meyer oder an Domenico Trezzini, dessen Arbeit in St. Petersburg bereits im 18. Jahrhundert eine sehr internationale Dimension hatte. Die Schweiz ist ein vergleichsweise kleines Land mit engen Grenzen. Früher oder später rühren wir in unserer Arbeit daran, weshalb einige Schweizer Architekturbüros ein internationales Portfolio anstreben oder mit ausländischen Kolleg*innen zusammenarbeiten. Wir haben in diesem Jahr einige schöne internationale Projekte gesehen. Ich beobachte aber auch eine gegenläufige Tendenz: Viele Architekturbüros streben vermehrt danach, ausschliesslich in der Schweiz tätig zu sein. Ein Grund für diese «neue Regionalität» liegt in einem geschärften ökologischen Bewusstsein begründet. Im Wesentlichen geht es darum, nicht reisen zu müssen und dort zu arbeiten, wo man Handwerk und die lokalen Materialien kennt. Ein weiterer Grund ist vermutlich finanzieller Natur: Die Honorare sind im Ausland in der Regel niedriger, sodass man es sich schlichtweg nicht leisten kann, ausserhalb der Schweiz zu bauen.
Es gibt hervorragende Beispiele von Architekturbüros, die sich auf das Lokale oder Regionale konzentrieren. Eines davon wird in der Kategorie Freizeit & Lifestyle ausgezeichnet. Wir müssen aber aufpassen, dass der Regionalismus nicht zu einer Nabelschau wird und daraus ein Überlegenheitsdenken entsteht. Für meine eigene Arbeit ist das internationale Handlungsfeld und das damit verbundene Hinterfragen der eigenen Position immens wichtig.
In der Kategorie Next Generation werden 2024 erstmals nicht mehr einzelne studentische Arbeiten prämiert, sondern herausragende Entwurfsstudios von den Schweizer Architekturhochschulen eingereicht. Inwiefern trägt unsere Idee, Professuren, Assistierende und Studierende für ihre gemeinsame Arbeit auszuzeichnen, Früchte?
LM Angesichts des bereits beschriebenen Paradigmenwechsels in unserer Gesellschaft ist es nur konsequent, die Debatte auf die Architekturhochschulen auszuweiten. Als Ideenschmieden mit einem privilegierten Blick in die Zukunft sind sie geradezu prädestiniert. Denn dort, wo die nächste Generation ausgebildet wird, treten sie als Experimentierfelder, in denen weniger praktisch und mitunter radikaler gedacht werden darf, in den Vordergrund. Die neu ausgerichtete Kategorie Next Generation widmet sich daher auch der Didaktik und würdigt die Lehrenden und ihr oft jahrzehntelanges Engagement. Auf der Suche nach Strategien und Instrumenten zur Lösung gesellschaftlich relevanter Fragen haben die Hochschulen in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Dies betrifft nicht nur die behandelten Themen und die gewachsene Offenheit gegenüber anderen Praktiken und Disziplinen, sondern auch einen weiteren Horizont für übergeordnete Fragestellungen mit inklusiven Ansätzen. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Preis als Teamleistung und nicht als etwas Individuelles zu verstehen – als eine Anerkennung aller Hochschulangehörigen, die sich gemeinsam auf einen Weg des Lernens und Wachsens begeben.

Dominique Salathé, Ludovica Molo, Elisa Schreiner, Manuel Herz und Mina Faas im Kunsthaus Baselland in Münchenstein | Foto: Jørg Himmelreich
Die neuausgerichtete Kategorie versteht sich als Schaufenster der aktuellen Schweizer Lehre. Welches sind die interessantesten Themen, um sich die eingereichten Entwurfsstudios drehen, beziehungsweise decken die übergeordneten Fragestellungen der Hochschulen die Anforderungen an die nächste Generation von Architekturschaffenden ab?
DS Die Schulen lernen schnell und gehen agil an neue Themen heran. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass einerseits bestimmte Entwurfsaufgaben konzeptioneller und abstrakter entwickelt werden und andererseits Architektur wieder betont konstruktiv gedacht wird. Die Universitätslandschaft ist in Bewegung. Jüngere Positionen entwickeln frische Strategien und vermitteln eine Entwurfskultur ohne Scheuklappen. Dabei fällt auf, wie offensiv die Studios neue Themen aufgreifen. Ob es um Re-Use von Bauteilen geht, die Erforschung von Lebensmittelkreisläufen oder um vernakuläres Bauen und neue Materialien – alles ist Architektur und jede Denkrichtung ist ausdrücklich erlaubt.

Daniel Buchner zeigte die Siedlung Rötiboden in Wädenswil. | Foto: Jørg Himmelreich
Roger, die Einreichungen der Schweizer Hochschulen zeigen den Ideenreichtum zukünftiger Architekturschaffender und kreisen um Entwürfe mit gesellschaftlichem Mehrwert, Re-Use und Nachhaltigkeit. Mit dem Lifetime Achievement Award ehren wir in diesem Jahr erstmals eine Persönlichkeit, die seit Jahrzehnten den Diskurs mit wegweisenden Lösungen prägt. Im Vergleich zwischen Jungen und Etablierten, wo überschneiden sich die Konzepte und Prioritäten, worin unterscheiden sie sich?
RB Wichtig ist heute die Frage nach den lokalen Ressourcen und wie diese genutzt werden können, um ein CO2-reduziertes Bauen zu ermöglichen. Sowohl junge Forscherteams als auch etablierte Büros untersuchen praktikable Ansätze im Umgang mit dem Bestand und wie dieser umgenutzt oder gegebenenfalls verdichtet werden kann. Auf der Suche nach Antworten werden auch die Skalierbarkeit von Bausystemen und Programmiermodellen diskutiert. Das architektonische Potenzial beider Gruppen ist, wenn man so will, nicht starr, sondern muss immer wieder neu ausgelotet werden. Es ist schön zu sehen, dass junge Architekt*innen diese Diskussionspunkte als Selbstverständlichkeit behandeln. Büros mit langjähriger Erfahrung sind sich dieser Themen ebenso bewusst, auch wenn es mit grösseren Bauvorhaben betraut oft schwierig ist, sie adäquat zu berücksichtigen. Der Lifetime Achievement Award würdigt mit Gion A. Caminada eine Haltung und Denkweise, die sich seit Jahrzehnten vorbildlich für das lokale und ressourcenschonende Bauen einsetzt und praktikable Lösungen hervorbringt. Darüber hinaus engagiert er sich in hohem Masse für soziale und wirtschaftliche Belange, die für seine Region von existenzieller Bedeutung sind. In diesem Sinne steht Caminada beispielhaft für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen und setzt mit seiner Arbeit Impulse auch und gerade für die nächste Generation.
Die Jury
Roger Boltshauser
ist Inhaber der Büros Boltshauser Architekten in Zürich sowie Boltshauser Architektur in München. Er ist Professor an der ETH Zürich und Mitglied des Baukollegiums Berlin.
Manuel Herz
ist Inhaber von Manuel Herz Architekten in Basel. Bis 2020 war er Professor für Stadtforschung an der Universität Basel und lehrte an der ETH Zürich sowie der Harvard Graduate School of Design.
Ludovica Molo
ist Direktorin des Istituto Internazionale di Architettura in Lugano und Mitinhaberin des studio we in Lugano. Von 2016 bis 2024 stand sie als Präsidentin dem Bund Schweizer Architekten BSA vor.
Dominique Salathé
ist Inhaber des Architekturbüros Salathé Architekten in Basel. Seit 2004 ist er Professor am Institut Architektur an der FHNW und unterrichtete als Gastdozent an der ETH Lausanne.
Der Text wurde in Swiss Arc Award Mag 2024–6 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.