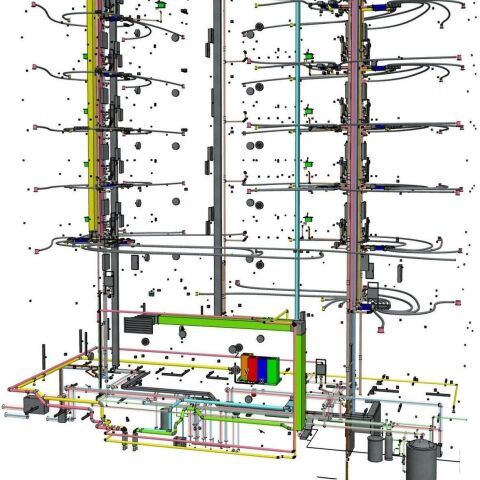Die Aufstocker – Simon Chessex spricht über Verdichtung
Genf wandelt sich, um den urbanen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Architekt*innen werden kreativ, um im Rahmen von Aufstockungen und Umnutzungen von Industrie- und Büroflächen in Wohnraum die Stadt zu verdichten und zugleich sicherzustellen, dass die Lebensqualität der Bevölkerung insgesamt gesteigert werden kann. Die Redaktion sprach mit Simon Chessex – einem wichtigen Akteur dieser Transformationen – über dessen Vision für Genf, aktuelle Projekte des Büros und besondere Herausforderungen, die mit der Verdichtung einhergehen.

Simon Chessex führt gemeisam mit Hiéronyme Lacroix das Architekturbüro Lacroix Chessex. Das Duo ist bestrebt, das Genfer Stadtgefüge qualitativ weiterzuentwickeln. Sie konnten zwei Aufstockungen verwirklichen; weitere sind in Planung. | Foto © Lacroix Chessex
Mit durchschnittlich fast 13 000 Personen pro Quadratkilometer ist Genf mit Abstand die am dichtesten besiedelte Stadt der Schweiz. Wie gelangte sie an diesen Spitzenplatz?
Genf wird oft als die kleinste Grossstadt bezeichnet. Sie ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und zieht entsprechend viele Menschen an. Die Stadt Genf – eine der 46 Gemeinden des Kantons – erstreckt sich über eine Fläche von gerade einmal 15 Quadratkilometern und beherbergt dennoch die Hälfte der Kantonsbevölkerung.
Doch man muss diese Zahlen zugleich relativieren. Einige Bereiche im Stadtzentrum sind tatsächlich sehr dicht besiedelt – vergleichbar mit Quartieren in Paris oder Barcelona. Aber es gibt auch weniger dichte Bereiche. Besonders kompakt ist die Stadt entlang der breiten Avenuen und rund um die Parks und Plätze. Da unterscheidet sich Genf von Städten wie beispielsweise London, wo über mehrere Quadratkilometer hinweg die gleiche Dichte vorhanden ist. Darüber hinaus verfügt Genf über grosse öffentliche Freiräume, wie zum Beispiel die Parks des Eaux-Vives und des Bastions, welche die Stadt atmen lassen.
Auch wenn sie immer dichter wird, gelingt es uns, dank qualitativ hochwertiger Projekte und einer sorgfältigen Weiterentwickung des öffentlichen Raums – bei der bewusst Vielfalt gefördert wird – die Lebensqualität zu erhalten.
Das kantonale Amt für Statistik schätzt, dass bis 2050 72 000 bis 151 000 neue Einwohner*innen nach Genf ziehen werden. Was bedeutet das für den Städtebau und die Architektur?
Dessen ist sich der Kanton Genf bewusst. In den letzten Jahren wurden sehr grosse Verdichtungsprojekte wie Les Communaux d’Ambilly, Les Cherpines oder La Chapelle-les Sciers angestossen. Allerdings geht alles extrem langsam voran. Es dauert gefühlte Ewigkeiten, bis die Projekte endlich in Angriff genommen werden. Die ersten Gebäude im Praille Acacias Vernets – einem zum Wohnen und Arbeiten umgenutzten Industriegebiet – befinden sich aktuell im Bau, obwohl die Wettbewerbe für diesen Stadtteil bereits 2005 ausgeschrieben wurden. Trotz der Langsamkeit bin ich optimistisch, dass gute Stadträume entstehen werden, denn die zugrunde liegende Planung ist intelligent.

Die Grands Projets im Kanton Genf | Karte © swisstopo
Sind Anpassungen der Zonenpläne angedacht? Werden zum Beispiel Einfamilienhausgebiete in dichtere Gebiete umgewidmet?
Der Kanton Genf hat seine Ziele mit einem kantonalen Richtplan und den Grands Projets klar definiert. Auf kommunaler Ebene wurden alle 46 Gemeinden aufgefordert, ebenfalls neue Richtpläne vorzuschlagen. Das heisst, alles ist umfassend geregelt.
Die Einfamilienhausgebiete sind jedoch ein heikles Thema. Die Hälfte der bebauten Fläche des Kantons ist als Zone 5 klassifiziert. Dort leben aber gerade einmal 13 Prozent der Einwohner*innen. Oder andersherum gesagt: Satte 87 Prozent der Bevölkerung des Kantons leben auf der Hälfte der bebauten Fläche!Vor einigen Jahren beschloss der Kanton, die Möglichkeit zu schaffen, die Einfamilienhausgebiete durch Ausnahmeregelungen zu verdichten. Die Idee war gut, hat aber anfangs nicht gut funktioniert. Statt eine qualitätvolle Verdichtung voranzutreiben, versuchten die Akteur*innen lediglich ihre Gewinne zu maximiere. So entstanden hässliche Reihenhausprojekte ohne jegliche Qualität und zahlreiche kleine Häuser aus den 1930er- bis 1960er-Jahren wurden abgerissen und prächtige alte Bäume in ihren Gärten gefällt. Ausserdem wurden zahlreiche Flächen mit Asphalt versiegelt.Als der Staatsrat sah, dass ihm die Situation entglitt, beschloss er ein Moratorium. Zwei Jahre lang war es nicht mehr möglich, die Einfamilienhauszonen zu verdichten. Dann wurde ein Handbuch verfasst. Darin wurden Kriterien definiert, die sicherstellen, dass diese Zonen nun qualitätvoll verdichtet werden.
2008 verabschiedete der Grosse Rat des Kantons Genf ein Gesetz, das in bestimmten Bereichen des Genfer Stadtzentrums das Aufsetzen von zwei neuen Stockwerken erlaubt, also sechs Meter mehr Höhe. Wie beurteilst du 16 Jahre später die Aufstockungen, welche durch diese Gesetzesänderungen möglich wurden?
Aufzustocken ist nicht die einzige Möglichkeit, um zu verdichten. Als Architekt*innen unterstützen wir grundsätzlich jeden Ansatz. Das Gesetz basiert auf einer Studie meines Büropartners Hiéronyme Lacroix, der sich mit seinem früheren Büro Guenin-Lacroix Architectes intensiev mit Fragen der Verdichtung von Genf auseinandergesetzt hatte. Seine beinahe utopische anmutende Studie weckte die Aufmerksamkeit des Politikers Thomas Büchi, der die Idee genial fand und sie politisch vorantrieb.
Anfänglich kam es aber zu ähnlichen Problemen, wie bei den Verdichtungen in den Einfamilienhausgebieten. Die ersten Aufstockungen waren schrecklich. Das führte zu einem Konflikt zwischen der Stadt – die sich um das Stadtbild sorgen machte – und dem Kanton, der um jeden Preis verdichten wollte. Nach einer Blockade der Aufstockungsprojekte wurden Bruno Marchant und das Büro Joud & Vergély gebeten, ein Regelwerk zu entwickeln, das den Aufstockungsprojekten einen Rahmen geben und deren architektonische Qualität sicherstellen sollte. Sie entwickelten daraufhin einen Leitfaden, die sogenannte «ABCD-Methode». Sie gibt eine Anleitung, wie der Charakter des Quartiers, der Strasse und des bestehenden Gebäudes beim Entwurf berücksichtigt werden kann.
Die Stadtbildkommission beurteilt jeweils, ob die eingereichten Projekte den Kriterien entsprechen. Ich persönlich finde diesen Leitfaden sehr gut: Er hilft uns, unsere Projekte im Kontext zu verorten. Nur gelegentlich stösst diese Richtlinie an Grenzen. Nicht jede Aufstockung kann mit der gleichen Methode durchgeführt werden kann, da jeder Kontext einzigartig ist.

Die jüngste Aufstockung von Lacroix Chessex in der Avenue Wendt hat eine kraftvolle Erscheinung. Ganz anders die Aufstockung des angrenzenden Gebäudes: Sie ist kaum ablesbar. | Foto: Olivier Di Giambattista
Ihr habt bereits zwei Aufstockungen von Wohngebäuden umsetzen können; zwei weitere sind in Planung. Bei diesen Projekten ist der Standort vorgegeben, die Gebäudestruktur macht klare Vorgaben zu den Dimensionen und die mögliche Zahl neuer Stockwerke ist per Gesetzt definiert. Auch die Tragfähigkeit der bestehenden Struktur setzt Grenzen. Wie viel Raum lassen Aufstockungen für architektonische Kreativität?
Mich beflügeln Einschränkungen. Ich reibe mich gerne an den Vorgaben, die der Bestand uns macht. Wir lassen uns auf die spezifischen Eigenschaften jedes Ortes ein. Wenn man offen ist, kann das eine reiche Quelle für Inspiration sein.
Vielleicht können wir mit der Zeit ganze Familien von Aufstockungen schaffen, die auf die verschiedenen Gebäudetypen aus den unterschiedlichen Epochen zugeschnitten sind. Doch im Moment begreifen wir jede Situation als einzigartig und freuen uns darauf, sie zu analysieren und uns den jeweiligen Herausforderungen zu stellen. Das spornt uns an und entzündet unsere Kreativität.
Gerne möchte ich auf eure Aufstockung in der Avenue Wendt genauer eingehen. Das Gebäude nebenan wurde ebenfalls erhöht, jedoch mit einem völlig anderen Ansatz. Die Architekt*innen entschieden sich dort dafür, das Äussere der beiden neuen Stockwerke an den Bestand anzugleichen und das Gesims, welches vorher den oberen Abschluss gebildet hat, zu entfernen. Was hältst du von diesem Ansatz?
Als wir mit unserem Projekt begannen, wussten wir bereits, was nebenan geplant war. Wir arbeiteten am Vorentwurf, als sie mit dem Bau anfingen. Die Kolleg*innen waren uns etwa eineinhalb Jahre voraus. Für sie heisst Aufstocken ganz einfach weitere Etagen nach dem Vorbild der unteren Stockwerke hinzuzufügen. Weil auch die Fassade des Bestandes renoviert wurde, konnten sie Alt und Neu optisch miteinander verschmelzen. Indem sie das Gesims entfernten, haben sie jedoch leider das einzige qualitative Element des Gebäudes entfernten.
Unser*e Bauherr*in wollte leider die Fassade des bestehenden Gebäudes nicht erneuern. Und uns war es wichtig, das Gesims zu erhalten, da es dem Gebäude eine interessante Gliederung verleiht.

In den neu geschaffenen Stockwerken gibt es lange Balkone, die den Bewohner*innen grossartige Aussenräume bieten. | Foto: Olivier Di Giambattista
Eure Aufstockung unterscheidet sich radikal von der Herangehensweise beim Nachbargebäude und ist formal auch komplett anders als der Bestand, auf den es aufgesetzt wurde. Offensichtlich möchtet ihr klar zeigen, dass es sich um eine Aufstockung handelt. Zudem wird damit dem vorher eher unscheinbaren Gebäude ein neuer, spannender Ausdruck verliehen. Es wirkt nun viel lebendiger und erhaben.
Städte sind immer Collagen. Das funktioniert meist sehr gut, denn Widersprüche können bereichernd sein. Anders als beim Nachbargebäude war bei uns nicht vorgesehen, die Fassade des Bestandes zu überarbeiten. Auch daher haben wir die Aufstockung als ein eigenständiges Element artikuliert und keinen Dialog mit dem Nachbarn gesucht. Wir haben uns entschieden, dem Gebäude eine Art Krone aufzusetzen, ihm einen Abschluss zu geben und es – so wie du sagst – erhabener zu machen.
Damit verweist ihr auf eine lange Tradition in der Architektur, ein Gebäude in drei Teile – Sockel, Schaft und einem Kapitell oder einen anderen oberen Abschluss – zu gliedern.
Diese Elemente sind in unserem architektonischen Ansatz sehr wichtig. Als der Wettbewerb für das Projekt ausgeschrieben wurde, musste jedes Team ein Konzept vorlegen. Unseres war von griechischen Säulen inspiriert. Wir erklärten, dass die Aufstockung die Rolle einer Bekrönung übernehmen und gleichzeitig das Gesimses erhalten werden könnte. Das überzeugte die Entscheidungsträger.
Dass der Aufbau eine Holzkonstruktion ist, war Wunsch der Kund*in. Uns war das recht, da sie leicht ist und für Aufstockungen ideal. Statt Alt und Neu nur durch einen Rücksprung zu artikulieren hilft auch der Materialwechsel, die beiden Bauphasen klar ablesbar zu machen. Allerdings sind nicht alle begeistert vom Einsatz von Holz als Baumaterial im städtischen Kontext. Es altert, verändert sein Aussenen und braucht Pflege. Für manche sind das negative Aspekte. Für uns hingegen ist es Teil des Reizes des Materials, denn es lebt.
Vielleicht müsste man Aufstockungen weniger als zusätzliche Etagen, denn als grosse Dächer begreifen. Dann wäre Holz gar nicht so ungewöhnlich, da auch in den Städten die meisten Dachstühle aus Holz sind.
Einverstanden. Wir haben zudem auf ein Haus im Chalet-Stil in der unmittelbaren Nachbarschaft verwiesen. Das hat die Behörde überzeugt, dass Holz an diesem Ort ins Stadtbild passen würde.
Zudem geht es bei einer Aufstockung vor allem um Leichtigkeit. Bevor wir mit einem Projekt beginnen, bitten wir unsere Bauingenieure, die Struktur des Gebäudes zu analysieren, um festzustellen, wie viele neue Stockwerke es tragen kann. Leichtigkeit steht jedoch im Widerspruch zu den Anforderungen der Bauphysiker und Akustiker, die Masse bevorzugen. Wir jonglieren kontinuierlich mit mehreren Faktoren, um die besten Lösungen zu finden. Holz ist natürlich nicht die einzige Option für die Struktur einer Aufstockung. Wir träumen zum Beispiel davon, auch mit Stahl bauen zu können. Holz wird jedoch häufig verwendet, da es ein positiveres Image und eine bessere CO2-Bilanz hat, Fragen des Brandschutzes beantwortet und preislich konkurrenzfähig ist.

Der hölzerne Aufbau mag zum bestehenden Bauwerk einen Kontrast bilden. Er etabliert jedoch einen Dialog zu anderen Gebäuden in der Nachbarschaft – beispielsweise zum Wohnhaus im Chaletstil, welches auf dem Foto zu sehen ist. | Foto: Olivier Di Giambattista
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Ansatz dieser Aufstockung ein ganz anderer ist, als bei eurer ersten in der Rue de Lausanne in Genf?
Ja, das war ein anderes Konzept, weil auch der Kontext ein anderer ist. Wenn man an unserer ersten Aufstockung vorbeigeht, bemerkt man sie kaum oder erst auf den zweiten Blick. In der Avenue Wendt haben wir uns hingegen wie beschrieben für einen bewussten Kon-trast entschieden. Wir verbergen nichts: Wir haben das Gebäude nicht «dekoriert». Die Holzstruktur verleiht mit ihrer natürlichen Materialwirkung der Architektur ihren Ausdruck.
Und auch die Wohnungstypen sind sehr unterschiedlich. In eurer ersten Aufstockung sind sie komplex. Dort habt ihr untere anderem Halbgeschosse eingeführt. In der Avenue Wendt scheinen sie hingegen viel simpler.
In der Avenue Wendt haben wir uns ganz klar für Standardwohnugen entschieden. Die Wohnungen sind durchgesteckt – mit einem Tagesbereich auf der Seeseite und einem Nachtbereich auf der anderen Seite mit Blick auf den Jura. Im Gegensatz zur Aufstockung in der Rue de Lausanne haben wir nicht nach einer spezifischen Typologie gesucht. Es sind gute solide Grundrisse, aber bewusst nichts aussergewöhnliches. Manchmal funktionieren bei der Planung von Wohnungen einfache und effiziente Typologien am besten.
Beim Aufstocken macht die Tragstruktur des Bestandes für eine darauf gesetzte Holzstruktur gewisse Vorgaben. Das macht Aufstockungen komplex. Es gibt bestimmte Vorgaben, mit denen man arbeiten muss, während gleichzeitig neue, qualitativ hochwertige Räume geschaffen werden sollen.

In den standartisierten Wohnungen haben die Architekt*innen ein angenehmes Ambiente geschaffen, indem sie die Holzstruktur sichtbar liessen. | Foto: Olivier Di Giambattista
Die Wohnungskrise zwingt zum Neubauen, Umbauen und Aufstocken. Und sie führt auch dazu, dass Flächen, die bisher nicht für Wohnzwecke vorgesehen waren, umgenutzt werden. Kannst du uns etwas über euer Aufstockungsprojekt in der Rue du Valais erzählen, wo ihr Büroflächen in Wohnungen umwandeln werdet?
Das Umnutzen von Bürogebäuden in Wohnungen finden wir sehr spannend. Wir haben es auch zum Thema unserer Entwurfsklasse an der Hochschule für Architektur in Freiburg gemacht. Das Bürogebäude an der Rue du Valais wird komplett entkernt; nur die Struktur bleibt erhalten. Es ist aufregend, ein Gebäude von seinem Skelett ausgehend neu zu denken, alle Innenräume neu zu entwickeln und ihm eine neue Haut zu geben. Ausserdem werden wir es aufstocken. Die Lage des Gebäudes ist dazu ideal: Es versperrt niemandem die Sicht, es gibt einen öffentlichen Freiraum in der Umgebung und es liegt in der Nähe des Sees.
Wir haben vor kurzem die Baugenehmigung erhalten und im nächsten Jahr wird mit der Umsetzung begonnen. Wir werden etwa 50 neue Wohnungen realisieren können. Das ist fantastisch! Für die Romandie ist dies diese Umwandlung eines Verwaltungsgebäudes in Wohnungen ein Pilotprojekt.
Die Struktur des Gebäudes macht die Umwandlung in Wohnungen sicher einfach.
Genau, wir haben das Glück, dass es nur Stützen mit grossen Platten hat. Die Positionen der Stützen geben uns Hinweise, wie wir die Grundrisse entwerfen.
Wenn du fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schaust: Welche Themen werden euch und die Architekt*innen in Genf wahrscheinlich besonders beschäftigen?
Aus dem Bevölkerungswachstum ergeben sich für mich drei grosse Themen- und Aufgabenfelder. Die Verdichtung durch Aufstockungen ist wie von uns besprochen auf einem guten Weg. Mobilität und Biodiversität sind zwei weitere wichtige Themen, die uns beschäftigen werden. Meiner Meinung nach gibt es zu viele Autos in der Stadt und dementsprechend werden derzeit viele Flächen als Parkplätze genutzt. Im Moment muss für jede neue Wohnung ein Parkplatz geschaffen werden. Das ist zu viel. Wir müssen die Stadt so umbauen, dass möglichst viel zu Fuss erledigt werden kann – Stichwort 15-Minuten-Stadt. Auch der öffentliche Verkehr muss weiter ausgebaut werden. Wenn wir die ganzen parkenden Autos an den Strassenrändern verschwinden lassen könnten, wäre das toll.
Ein wichtiges Thema wird auch die Aufwertung der bestehenden Freiräume sein. Hier in Genf beginnen wir bereits damit, die Parks und Uferzonen am See so umzubauen, dass sie möglichst viele Nutzungsmöglichkeiten bieten. Dabei muss aber auch an die Biodiversität gedacht werden. In den nächsten Jahren wird es darum gehen, die Freiräume so zu gestalten, dass sie Menschen, Tieren und Pflanzen gleichermassen Raum lassen. Die Renaturierung der Ufer von Eaux Vives ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel für die Stärkung des öffentlichen Raums, bei der auch ökologische Aspekte berücksichtigt wurden. Wenn wir in diese Richtung arbeiten, können wir viel für die Lebensqualität der Menschen und den Erhalt der Biodiversität erreichen.
Das Interview wurde für Arc Mag 2024–5 produziert. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/magazin