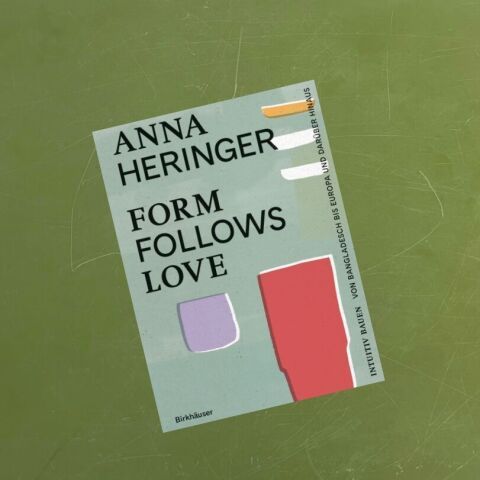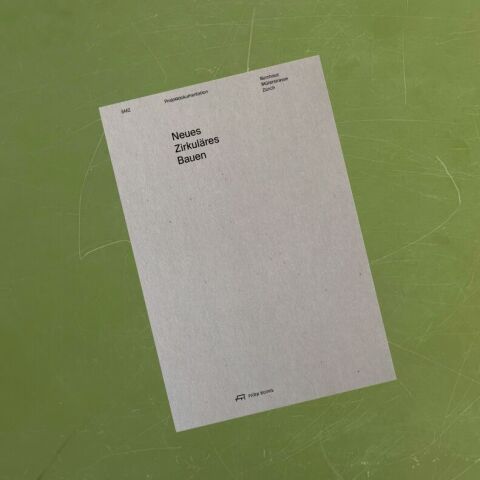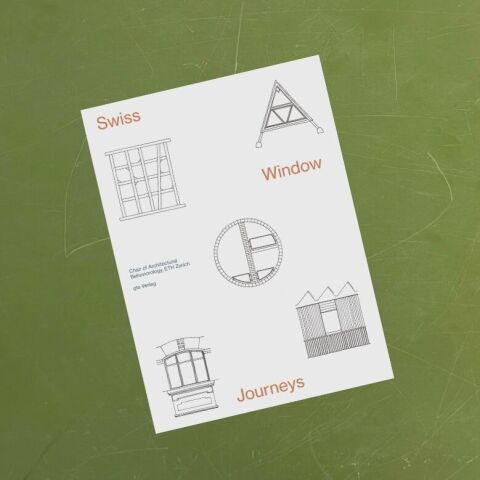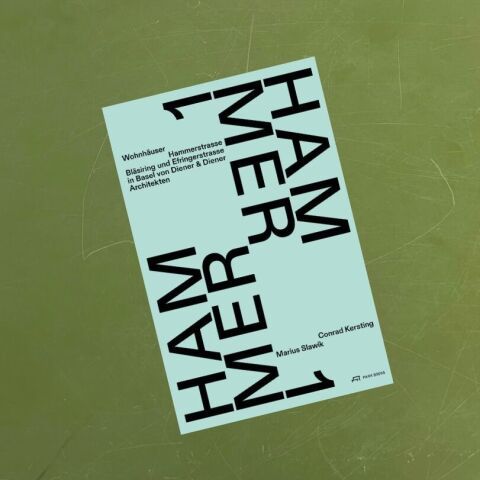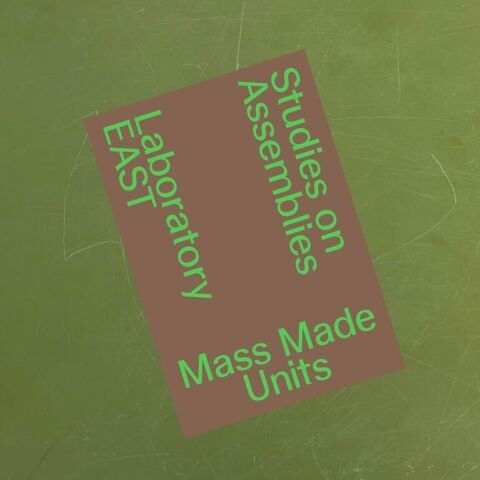Schweizer Grenzen im Corona-Lockdown 2020
Drahtzäune, Baukegel, Betonbarrieren: Der Basler Fotograf Jan Sulzer hat in einem Fotobuch die geschlossenen Grenzen im Frühjahr 2020 dokumentiert. Die provisorischen Absperrungen sind bauliche Zeugen der Ausnahmesituation.
Es gibt viele Bilder, die von der Corona-Pandemie im Kopf bleiben werden: die Militärlaster, die Särge in Bergamo abtransportieren oder Bilder von Covid-19-Patienten am Beatmungsgerät. Nicht zuletzt wird die pandemiebedingte Ausnahmesituation deutlich in den Fotos geschlossener Grenzen. Europaweit machen die Länder von März bis Juni 2020 ihre Grenzen dicht, um die Verbreitung des Virus zu stoppen.

Riehen Basel: Der einsetzende Regen scheint diese Kühe vermutlich mehr als die frisch markierte Landesgrenze zu interessieren. © Jan Sulzer
Über Jahre verwachsene Grenzregionen
Besonders schmerzlich wird diese Einschränkung in den Grenzregionen empfunden, die über viele Jahre miteinander verwachsen sind. Eine Erfahrung, die auch der in Basel lebende Fotograf und Filmemacher Jan Sulzer macht. «Seit dem Zweiten Weltkrieg ist so etwas Einschneidendes in der Region nicht mehr geschehen. Im Dreiländereck ist man regelmässig in Deutschland und Frankreich unterwegs, um einzukaufen und Ausflüge zu machen. Wenn man durch den Wald geht, gibt es viele Stellen, wo man gar nicht weiss, in welchem Land man sich befindet», betont Sulzer.
Diese neue Realität weckt beim Basler während des Lockdowns die künstlerische Neugier: Er beginnt, Grenzübergänge in Basel-Stadt und Basel-Land zu besichtigen, dann erweitert er sein Einzugsgebiet. «Die Fotos waren als privates Notizbuch gedacht, aber als ich immer weitergereist bin, kam ich auf die Idee, diese Ausnahmesituation in einem Fotobuch festzuhalten», erzählt der Fotograf.
Wochenlang fährt Jan Sulzer in dieser Zeit die Grenzkantone ab, rund 200 Absperrungen auf Hauptverkehrsstrassen, in Vorgärten, in Wohngebieten, auf Brücken und vor Haltestellen fotografiert er. 78 davon hat er für den Bildband «abgeriegelt. Schweizer Grenzen im Corona-Lockdown 2020» ausgesucht. Mit Hilfe einer offiziellen Karte der eidgenössischen Zollverwaltung und Google Maps findet Sulzer den Weg auch zu kleinen, abgelegenen Grenzübergängen. «Es war immer ein Überraschungsmoment dabei, da ich nie wusste, was mich erwartet.»

Montlingen St. Gallen: Die Absperrung würde mehr zu einer improvisierten Baustelle passen. © Jan Sulzer
Improvisierte Installationen aus Beton, Draht und Absperrbändern
Bauzäune, rot-weisse Absperrbänder und -kegel, Betonkonstruktionen, Drahtzäune und -gitter, Metallbarrieren, verrostete Schlagbäume, mal allein, mal in den verschiedensten Kompositionen zusammengewürfelt, werden von offizieller Seite zur Grenzschliessung eingesetzt. Oft muten die Barrieren improvisiert an, wie auf die Schnelle aus den Beständen des Werkhofes zusammengesucht.
«Die Konstruktionen aus Betonelementen, Bauzäunen und Absperrbändern wirken wie Installationen im öffentlichen Raum», beschreibt Jan Sulzer seine Eindrücke der Sperren, die auch kantonale Besonderheiten widerzuspiegeln scheinen: In Basel setzen die Verantwortlichen verstärkt auf leichtere Drahtkonstruktionen, robuste Metall-Barrieren bevorzugt man im Jura, massive Betonelemente dominieren in Schaffhausen. «Ich musste oft schmunzeln, als ich die verschiedenen Bauten entdeckt habe, die teilweise sehr skurril wirkten. Mal flatterte nur ein Absperrband im Wind, andere Übergänge waren gleich mehrfach gesichert.»
Um einen einheitlichen Stil in seinen Fotos zu kreieren, entwickelt Sulzer eine spezifische Bildsprache. Er wählt ein 35mm Objektiv und fotografiert im digitalen Vollformat. Spielt das Wetter nicht mit, benutzt er den Aufenthalt, um Skizzen zu machen und die richtige Perspektive zu finden. «Wenn ich wusste, das ist ein interessanter Grenzübergang, bin sogar öfter hingefahren, um das optimale Bild zu bekommen.»
Auffällig ist die Abwesenheit von Menschen in den Aufnahmen. Früh hat sich der Fotograf entschieden, keine Menschen abzubilden, «So kann der Betrachter seine eigenen Gedanken hineinprojizieren und die Leerstellen füllen», erklärt Jan Sulzer.

Weilstrasse: Wurde hier versucht, möglichst viele Gegenstände auf einer schmalen Grenzlinie zu platzieren? © Jan Sulzer
Nicht immer allein am Grenzposten
Ganz unbeobachtet und allein bleibt der Basler in den Sperrgebieten jedoch nicht immer. So taucht an einem verlassenen Grenzposten plötzlich ein Grenzwächter aus einem Gebüsch auf und sorgt für kurzes Herzrasen. Und eine gemischte Patrouille aus jungen Rekruten und Grenzwächtern verbietet Sulzer gleich zu Beginn seiner Tour im Sperrgebiet zu fotografieren. Daraufhin besorgt er sich eine Genehmigung der Eidgenössischen Zollverwaltung, was «sämtliche Probleme löst». Aber es gibt auch positive Begegnungen mit Staatsbediensteten. Manchen Grenzbeamten ist es zum Beispiel wichtig, ihren Arbeitsplatz im besten Licht darzustellen. «Zum Teil haben die Grenzwächter Warnhütchen extra so hingestellt, damit sie gut aussahen.»
Nicht nur Grenzwächter begegnen dem Fotografen. Menschen, die Familie und Freunde im Nachbarland besuchen wollen, nutzen die Schlupflöcher der «grünen Grenze». Liebespaare treffen sich an Grenzzäunen in Innenstadtbereichen. Besonders in Erinnerung bleibt dem Basler eine Begegnung mit einer Dreigenerationenfamilie in Schaffhausen. Die Grosseltern standen auf deutscher, die Tochter mit Ehemann und Neugeborenem auf der Schweizer Seite. «Sie hielten die Abstände die ganze Zeit streng ein. Die Familie hat einfach den Sonntagnachmittag miteinander verbracht.»
Die Foto-Tour erleichterte Sulzer auch selbst den Umgang mit der Pandemie. «Wegen Corona wollte ich keine Menschen treffen und war froh, mit dem Projekt aus dem Haus zu kommen. An den Grenzübergängen herrschte oft Ruhe und so bekam die Tour fast etwas Meditatives.»