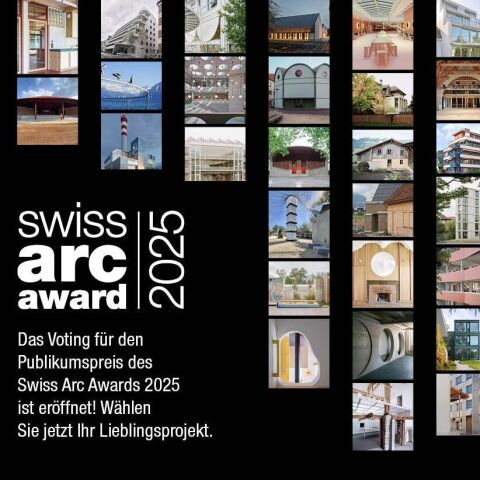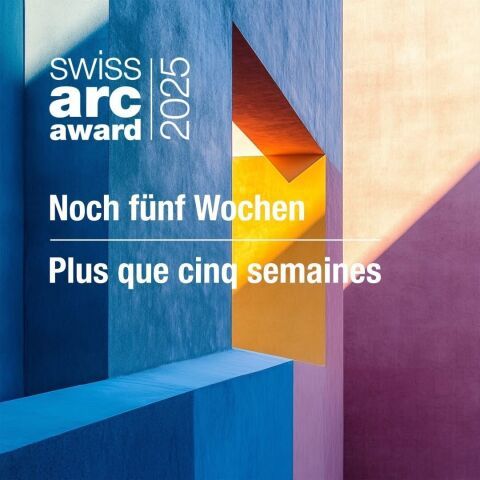Schönheit in Krisenzeiten – die Arc Award Jury 2023 im Interview

Eine zweitägige Tour führte die Arc Award Jury Anfang Juli durch die Deutsch- und Westschweiz. Im Bild konferieren Ludovica Molo, Philipp Scheidegger, Roger Boltshauser, Dominique Salathé und Manuel Herz vor Ort mit Marcel Baumgartner (2.v.l.) vor der Schulanlage Röhrliberg in Cham. | Foto: Nina Farhumand
Was fiel Euch bei den für den Arc Award eingereichten Projekten in diesem Jahr besonders auf? Zeigen sich neue Ansätze und grössere Entwicklungslinien?
Roger Boltshauser Ich war zum ersten Mal in der Arc Award Jury und war überrascht über die grosse Zahl der eingereichten Projekte sowie deren Qualität. Es ist auffallend, dass sehr viele der Autor*innen sich mit den Zusammenhängen von Bauen und Klima befasst haben. Dabei sind die Konzepte mannigfaltig: Es gibt unterschiedlichste Ansätze im Umgang mit dem Bestand und diverse Strategien bei der Suche nach und dem Einsatz von nachhaltigen Materialien. Beispielsweise die Frage, wie man eine Fotovoltaik-Anlage gestalterisch aktiviert oder wie man Haustechnik eher als passives System denn als komplexe Maschine angehen kann, wurden thematisiert. Flexibilität und Zirkularität sind zwei weitere Schwerpunkte. Parallel spürt man die Beschäftigung mit sozialen Aspekten im Umgang mit Dichte im städtischen Kontext. Es ist spannend zu sehen, wie sich all diese Fragen in der Architektur niederschlagen. Man könnte dies als eine Art Recherche zur Findung einer neuen architektonischen Sprache bezeichnen.
Ihr habt über 20 Gebäude besucht. Wie wichtig ist die Erfahrung vor Ort, um eine gerechte Entscheidung zu treffen?
Ludovica Molo Architektur lässt sich in den zwei Dimensionen von Zeichnung und Fotografie nicht vollständig erfassen. Die eingereichten Unterlagen sind zwar für eine Fachjury, die sich täglich mit diesen Themen beschäftigt, aussagekräftig und haben uns geholfen, eine erste Auswahl zu treffen. Um aber das wahre Wesen der Architektur zu erfassen, nämlich die Einbettung in den Kontext, die Erdung, die Tektonik, die Qualität der Räume, den Charakter der Materialien und auch jenes undefinierbare emotionale Element, das jedem Projekt innewohnt und das wir Atmosphäre nennen könnten, muss man ein Gebäude betreten und es berühren. Erst dann spürt man, wie die Architektur vibriert. Genau das haben wir auf der Juryreise getan. Es ist schön, das Privileg zu haben, all diese faszinierenden Objekte gemeinsam besuchen zu können. Die Bauten, die wir besichtigt haben, haben sich uns in ihrer ganzen Komplexität gezeigt. Manchmal haben sie uns verblüfft, manchmal haben sie uns ungelöste Aspekte offenbart, aber immer luden sie uns zum Nachdenken und zum angeregten Austausch ein.

Im Schulhaus Wallrüti von Schneider Studer Primas konnte sich die Jury von der räumlichen Effizienz und gleichzeitigen Grosszügigkeit der Lauben überzeugen. | Foto: Jørg Himmelreich
Letztes Jahr gab es beim Arc Award dezidiert einen Preis für Nachhaltigkeit. Ihr habt uns als Jury darauf hingewiesen, dass nachhaltiges Bauen eigentlich in jeder Kategorie ein unabdingbares Kriterium sei. Was tut sich in Hinsicht auf Ökologie beim Bauen in der Schweiz? Und hat dieser Anspruch eure Entscheidungen bei der Auswahl der Gewinner*innen geleitet?
Manuel Herz Wir haben bereits im letzten Jahr darüber spekuliert, dass der Begriff der «Nachhaltigkeit» irgendwann aussterben wird, da sie beim Bauen eine Selbstverständlichkeit werden muss. Diese Entwicklung konnten wir dieses Jahr bereits wahrnehmen: Einerseits wurde eine Vielzahl von spannenden Projekten in der Kategorie Transformation eingereicht, zum anderen weisen viele der Projekte, die in anderen Kategorien wie Wohnen oder Arbeiten für den Preis vorgeschlagen wurden, Aspekte von Nachhaltigkeit auf. Diese sind immer häufiger keine Add-ons mehr, sondern strukturell in das Entwurfskonzept eingebunden. Das hat uns sehr gut gefallen. Wir sind nicht mit der Zielsetzung in die Sitzungen gegangen, ausschliesslich nachhaltige Projekte auszuzeichnen. Es ist aber schon so, dass Projekte, die augenscheinlich unreflektiert zum Thema stehen – sagen wir rein hypothetisch ein Einfamilienhaus aus Beton auf der grünen Wiese – es sehr schwer haben, uns zu überzeugen. Im Zuge der Klimakrise verändert sich auch unsere Auffassung von Ästhetik. Manche neuen Gebäude, die vor ein paar Jahren noch faszinierend waren, nehmen wir heute nicht mehr als sinnlich wahr beziehungsweise finden, dass sie keinen interessanten Beitrag zum Architekturdiskurs leisten.

Philipp Esch zeigte an Plänen auf, welche Teile des ehemaligen Weinlagers Bestand sind und welche hinzugefügt wurden. | Foto: Jørg Himmelreich
Was tut sich derzeit in der Romandie und dem Süden?
LM In der Vergangenheit haben wir praktisch bei jeder Ausgabe des Arc Award sehr wertvolle Neubauten aus der Westschweiz ausgezeichnet. Leider sind dieses Jahr weniger Projekte aus der Romandie eingereicht worden als sonst. Das ist aber nicht repräsentativ. Das prämierte Natursteinhaus in Genf zeigt, dass in der Westschweiz wegweisende Architektur entsteht. Es ist ein Beispiel für Qualität und konstruktive Innovation. Ich möchte in diesem Zusammenhang zwei weitere Aspekte ansprechen. Die Architekturproduktion der Regionen ist kaum vergleichbar. In unterschiedlichen kulturellen Kontexten werden unterschiedliche Architekturen entworfen und realisiert. Es ist wichtig, dieser Tatsache Rechnung zu tragen.
Unseren Leser*innen ist es zu verdanken, dass Projekte aus dem Tessin auf dem ersten und zweiten Platz des Publikumsvotings gelandet sind. Unter den nominierten Projekten waren in diesem Jahr fast gar keine Projekte von dort.
LM Trotz der Präsenz guter Architekt*innen wird im Tessin oft schlechte Architektur gebaut oder besser gesagt: Es wird ohne sie gebaut. Private Bauherren, vor allem bei grösseren Bauprojekten, führen oft keine Architekturwettbewerbe durch und tragen deshalb nicht genügend zur Förderung einer qualitativ hochstehenden Baukultur bei, wie dies in anderen Regionen der Fall ist. Hier gibt es noch viel zu tun. Eine Auszeichnung wie der Arc Award kann dazu beitragen, das Bewusstsein und die Verantwortung der Bauherrschaften zu stärken.

Elli Mosayebi von EMI Architekt*innen setzte die bewegliche Wand in einem Appartement im Wohnhaus an der Stampfenbachstrasse in Zürich in Bewegung. | Foto: Jørg Himmelreich
Was vermisst ihr in der Schweizer Architektur derzeit? Welche Themen oder Aufgaben müssten künftig intensiver angegangen werden?
DS Die Frage nach der Suffizienz, dem lustvollen «Weniger» wird noch viel zu selten untersucht. Hier braucht es unbedingt spannende Beispiele. Wollen wir unsere Probleme angehen, zum Beispiel die Frage der Wohnungsnot, braucht es aber auch Verantwortung im grossen Massstab. Wir werden unsere Probleme nicht einfach mit etwas Selbstbau und einem Solarpanel lösen können. Grundsätzlich sollten wir zukünftig Normen kritischer hinterfragen und etwas mehr zivilen Ungehorsam gegenüber den ganzen Regularien zeigen; hier sehe ich ein grosses Potenzial zugunsten einer Vereinfachung des Bauens. Und vielleicht sollten sich Architekt*innen wieder mehr um unsere Infrastrukturen kümmern. In Zusammenarbeit mit Ingenieuren und anderen Spezialisten gibt es dort viel zu tun.
Bei den eingereichten Arbeiten der Studierenden steht ebenfalls Nachhaltigkeit im Zentrum. CO2-arme Energieproduktion und Kreislaufwirtschaft waren zwei auffällige Themen in der Kategorie Next Generation.
RB Diese Themen beschäftigen die heutige Generation von Studierenden sehr. Mehr noch: Sie fordern die Auseinandersetzung mit ihnen geradewegs ein. Sie akzeptieren in der heutigen Zeit den Neubau auf der grünen Wiese nicht mehr. Ich war kürzlich an der Uni in Stuttgart an einem Vortrag, wo mir gesagt wurde, dass die Student*innen dort Neubauten als Aufgabenstellung neuerdings grundsätzlich verweigern! An der ETH Zürich ist das nicht anders: Ohne einen reflektierten Umgang zu Fragen des Klimas werden Semesteraufgaben nicht mehr einfach so akzeptiert. Es verwundert deshalb nicht, dass die Themen der Nachhaltigkeit die studentischen Eingaben dominieren. Aber die Impulse kommen nicht nur von den Studierenden. Auch die Professuren und Dozenturen an allen Schweizer Hochschulen leisten eine hervorragende Arbeit. Gerade die Schulen sind wichtige Orte zur kollektiven Reflexion zu diesem sehr komplexen, aber auch noch offenen Themenfeld. Auch hier könnte man von einer Art gemeinsamer Recherche zu den unterschiedlichsten Strategien und einer architektonischen Sprachfindung sprechen. Die Schulen übernehmen eine wichtige Vorreiterrolle.

Daniel Kasel vom Büro Knapkiewicz & Fickert führte bei Sonnenschein durch die Überbauung Vogelsang. Ein Wetter, das die Italianità der Siedlung unterstrich. | Foto: Jørg Himmelreich
Ihr habt euch entschieden, in diesem Jahr nicht die Arbeit eines einzelnen Studierenden auszuzeichnen, sondern ein Team – die Lehrstühle, die Assistierenden und alle Studierenden, die am Projekt Re-Use Pavillon mitgewirkt haben. Warum?
MH Es sind drei wesentliche Beweggründe, die uns geleitet haben: Als wichtigster ist hier ganz klar zu nennen, dass uns das Projekt des Re-Use Pavillons am meisten überzeugt hat. Das sollte bei einer Jury-Entscheidung immer im Vordergrund stehen. Wir haben aber auch realisiert, wie schwierig die Beurteilung von Einzelarbeiten ist, da häufig die Aufgabenstellungen der Professur im Rahmen der Eingaben nicht dokumentiert wurden. Auch ein Vergleich mit anderen Studienarbeiten desselben Semesterthemas war fast nie möglich. Zudem reichen die Studienprojekte von sehr theoretischen, spekulativen Arbeiten über Experimente mit Material am Eins-zu-eins-Objekt bis hin zu klassischen Entwurfsprojekten ein. Somit ist es extrem schwierig zu vergleichen. Für eine Auszeichnung wie die Next Generation müssten wir das aber können. Last, but not least müssen wir auch erkennen, dass die kreative Arbeit der Studierenden zwar ein sehr wichtiger, aber nur ein Teil der «Gesamtleistung» eines Entwurfssemesters ist.
Wir möchten mit der diesjährigen Entscheidung anerkennen, dass auch die Lehrenden einen entscheidenden kreativen Beitrag leisten. Entsprechend wollen wir den Effort aller Beteiligten, von den Studierenden, den Assistierenden, den Professor*innen bis hin zu externen Unterstützenden in ihrer Ganzheit betrachten. Architektur ist grundsätzlich eine kollaborative Disziplin. Dies möchten wir bei der Prämierung in der Kategorie Next Generation durch unsere Auswahl zum Ausdruck bringen.
Kurzportraits
Roger Boltshauser ist Inhaber des Büros Boltshauser Architekten in Zürich sowie Boltshauser Architektur in München. Aktuell ist er Dozent an der ETH Zürich und Mitglied des Baukollegiums Berlin.
Manuel Herz ist Inhaber des Büros Manuel Herz Architekten in Basel. Bis 2020 war er Professor für Stadtforschung an der Universität Basel und übte diverse Lehrtätigkeiten an der ETH Zürich sowie der Harvard Graduate School of Design aus.
Ludovica Molo ist Direktorin des Istituto Internazionale di Architettura in Lugano und Mitinhaberin des studio we in Lugano.
Dominique Salathé ist Inhaber des Architekturbüros Salathé Architekten Basel. Seit 2004 ist er Professor am Institut Architektur an der FHNW und lehrte als Gastdozent an der ETH Lausanne. Schweizweit ist er zudem als Experte und Fachjuror tätig.