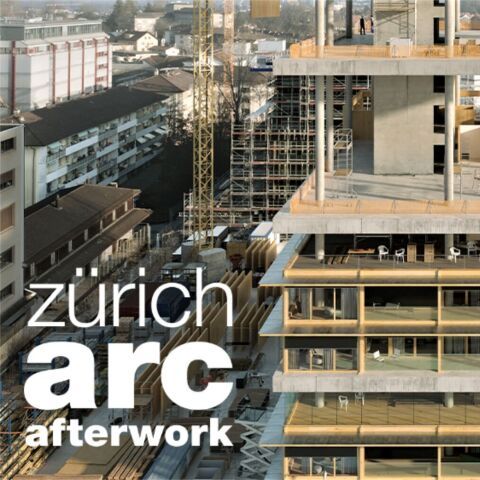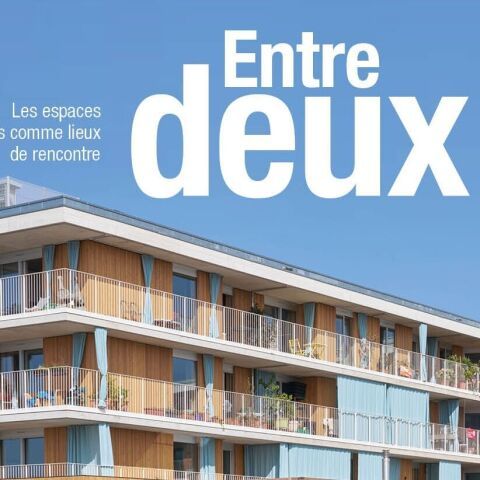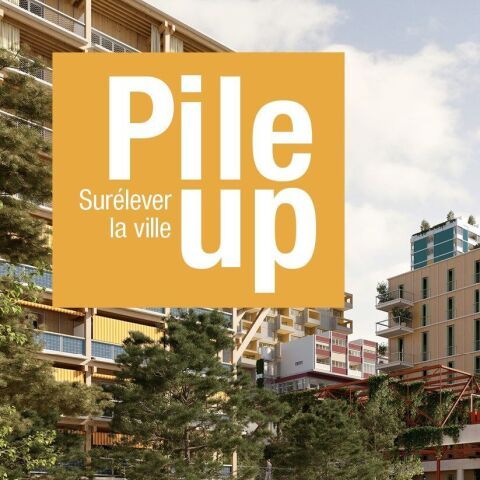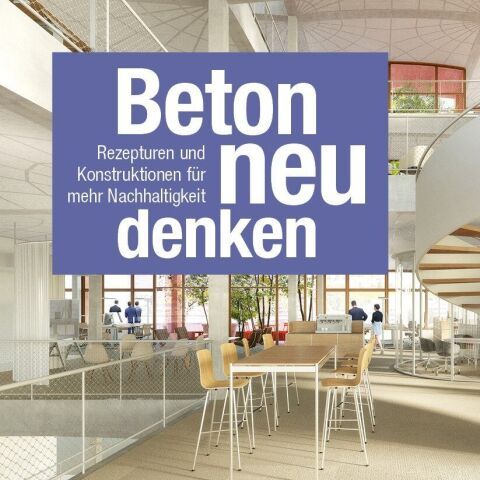Gegen die Wohnungsnot – ein Plädoyer für Fluid Spaces
Die meisten Grossstädte wachsen. In der Folge steigen Mieten und Wohnraum wird knapp. Gleichzeitig wächst der durchschnittliche Flächenverbrauch und verschärft das Problem. Immer mehr Menschen leben in (unnötig) grossen Wohnungen oder Häusern, besonders häufig Alte. Gleichzeitig mehren sich Klagen über zunehmende Vereinsamung. Höchste Zeit also, beim Wohnungsbau neue Wege zu gehen. Doch die Immobilienwirtschaft trägt diesen Veränderungen bisher kaum Rechnung. Sie setzt weiter vorrangig auf Drei- und Vier-Zimmerwohnungen und dimensioniert Gemeinschaftsflächen eher klein. Beim Arc Afterwork am 15. Juni 2023 in der Giesserei in Oerlikon stehen deshalb drei Fragen im Vordergrund: Wie können flexible und dennoch kompakte Wohnräume für verschiedene Lebensmodelle und -phasen gestaltet werden? Wie ist es möglich, neue Formen des Miteinanders zu stimulieren? Und wie kann Wohnen künftig nachhaltiger und kostengünstiger sein?

Die gemeinschaftliche Fläche im Erdgeschoss im genossenschaftlichen Wohnhaus San Riemo in München wurde von den Bewohner*innen «Lobby» getauft. Mit einer Küche und einer Werkstatt regt sie zu gemeinsamen Tätigkeiten an. Waschmaschinen und Regalwand können bei Bedarf hinter den Vorhängen verschwinden. Photo: Petter Krag
Der nächste Arc Afterwork bringt drei der spannendsten Architekturbüros zusammen, wenn es um Innovation im Wohnungsbau geht. Maria Conen (Conen Sigl Architekt*innen, Zürich), Anne Femmer (summacumfemmer Architekt:innen, Leipzig) und Annegret Haider (einszueins architektur, Wien) werden ihre Konzepte und Arbeiten zu diesem Thema vorstellen. Die drei Büros verbindet die Suche nach neuen Typologien, nach mehr Vielfalt und neuen Formen des Zusammenlebens. Ihren Arbeiten liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Konstellationen, in denen zusammengelebt wird und die Bedürfnisse bezüglich des Wohnens generell im Wandel sind. Die Hetero-Zwei-Generationen-Kernfamilie ist zwar statistisch noch immer die häufigste Haushaltsform in der Schweiz, doch es gibt vermehrt Personen, die alleine leben oder in anderen fluideren Konstellationen. Entsprechend versuchen die Architekt*innen sich von herkömmlichen Grundrissschemata zu lösen. Sie suchen nach Konzepten für den Wohnungsbau, die diverseren Gruppen durch vielfältigere Möglichkeiten Raum gibt. Mitunter wird mit Typologien experimentiert, die mit geringem oder mittlerem Aufwand umkonfiguriert werden können.

Conen Sigl haben die Genossenschaftssiedlung Westhof auf dem Hochbord-Areal in Dübendorf aus vier grossen Elementen komponiert. Eine Zeile schirmt gegen den Lärm einer Bahnlinie ab. Parallel ragt eine Scheibe mit neun Geschossen empor und ein Kopfbau soll Passanten einladen, in den Hof einzutreten. Photo: Philip Heckhausen
Neue Gemeinschaften
Und weitere Themen sind diesen Büros gemeinsam: Sie wollen Architektur schaffen, die Nachbar*innen zu Hausgemeinschaften macht. Denn obwohl immer mehr Menschen sich bewusst entscheiden, alleine zu leben – gesamteuropäisch betrachtet, sind in Grossstädten Singlehaushalte bereits jetzt die beliebteste Wohnform – nimmt sowohl bei Jüngeren wie auch Älteren parallel ein Gefühl von Einsamkeit zu. Babyboomer, Generation Y und Z wünschen sich mehr Gemeinschaft. Sie sind offen zu Sharen – sein es Autos, Gegenstände oder Raum. Und dabei ist ihnen häufig die Qualität der geteilten Räume wichtiger als die Grösse der eigenen Wohnung. Und eine kollektiv organisierte häusliche Sorgearbeit wird weniger als bisher als Last, sondern als Chance begriffen, um ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen: Teilhabe ermöglicht Begegnungen und fördert die Solidarität unter den Bewohner*innen.Singles, Alleinerziehende, ältere Menschen, WGs, Patchwork-Familien, LGBTQI+, körperlich Beeinträchtigte, Menschen mit abweichenden kulturellen Praktiken: Die Immobilienwirtschaft hat eine ganze Reihe von Gruppen bislang nur wenig beachtet. Sie waren meist gezwungen, sich mit standardisierten Wohnräumen zu arrangieren. Gut gibt es im Architekturdiskurs mittlerweile Akteure, die sich dafür einsetzen, die gebaute Umwelt diverser und vielfältiger zu denken. Und dies schwappt langsam, aber sicher auf die Bauherrschaften über: An verschiedenen Orten hat eine Suche nach Lösungen begonnen, um die «anderen» stärker als bisher mit den Mitteln der Architektur einzubeziehen. Die Konstellationen, wann und wie lange wir wo zusammenleben, werden immer fluider: Bislang blieb bei Veränderungen nur die Wahl umzuziehen oder mitunter in zu grossen Wohnungen zu bleiben. Die Grundrisse des Genossenschaftshauses San Riemo der ARGE summacumfemmer Büro Juliane Greb beispielsweise formulieren dazu eine typologische Alternative. In diesem «atmenden Haus» können die Wohneinheiten bei Bedarf vergrössert, verkleinert, zusammengeschaltet oder geteilt werden, beispielsweise um gemeinsame Nutzungen wie Spielen, Homeoffice oder Atelier zu ermöglichen. Dazu haben die Architekt*innen auf einen Grundraster von 14 Quadratmeter grossen Raumeinheiten gesetzt. Diese und weitere Ansätze werden am 15. Juni diskutiert.

Gleis21 ist ein Baugruppenprojekt, das 2017-2019 in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs errichtet wurde. Geplant wurde es in einem partizipativen Verfahren von einszueins architektur. Dieses geförderte Heim umfasst 34 Wohneinheiten, zahlreichen Gemeinschafts- und vier Gewerberäumen. Aktuell leben 47 Erwachsenen und 20 Kinder dort. Photo: Hertha Huranus
Neue Systeme entwerfen
Zudem wird von den Protagonist*innen das Thema Nachhaltigkeit architektonisch angegangen. Neben Dichte und Mehrfachnutzbarkeit geht es auch um die Organisation - darum zu motivieren, den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren. Wohnarchitektur zu entwerfen, wird so zu mehr als einer Frage von Form und Material: zum Gestalten alternativer Lebensentwürfe. Die drei Teams experimentieren auch ökonomisch mit neuen Ansätzen, allem voran genossenschaftliche Modelle, um auch bei der Finanzierung Alternativen zu den bestehenden Standards aufzuzeigen. Obwohl der Bedarf an neuen Wohnungen in den europäischen Grossstädten kontinuierlich wächst, gibt es aktuell einen Einbruch im Wohnungsbau: Projekte werden storniert; hohe Baukosten und steigende Zinsen bremsen die Entwicklungen aus. Daher stellt sich die Frage: Können Bewohnende und Architekt*innen selber zu Investoren werden? Neben typologischen Aspekten wird es beim Afterwork daher auch um Ökonomie gehen. Genossenschaften, Konsortien, Vereine und Baugruppen – solche Modelle der Finanzierung werden immer wichtiger, um Alternativen im Wohnungsbau zu verwirklichen. Wenn sich nicht die passende Gruppe finden oder überzeugen lässt, werden Architekt*innen mitunter selber zu Genossenschaftlern und damit zu Bauherrschaften - auch davon wird bei diesem Event berichtet.
Mittlerweile sind alle Plätze beim Afterwork reserviert. Eine Anmeldung ist daher leider nicht mehr möglich.