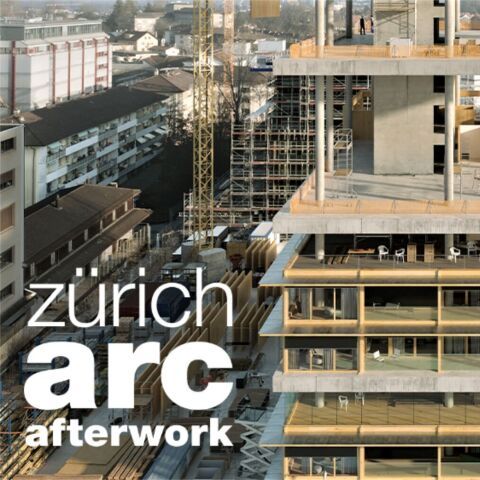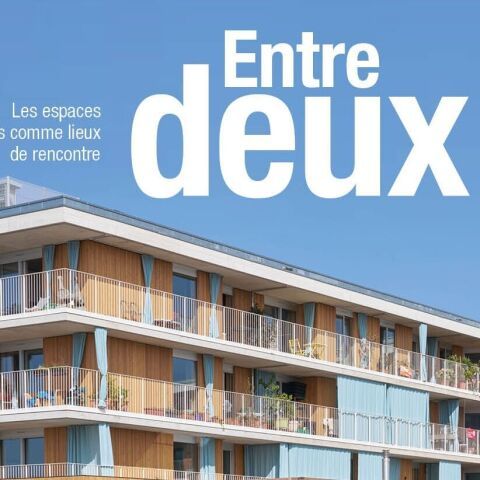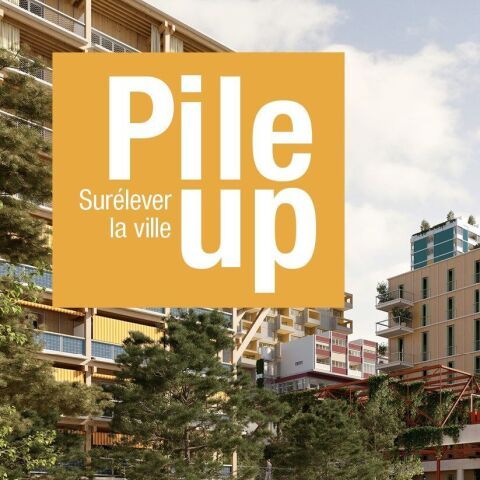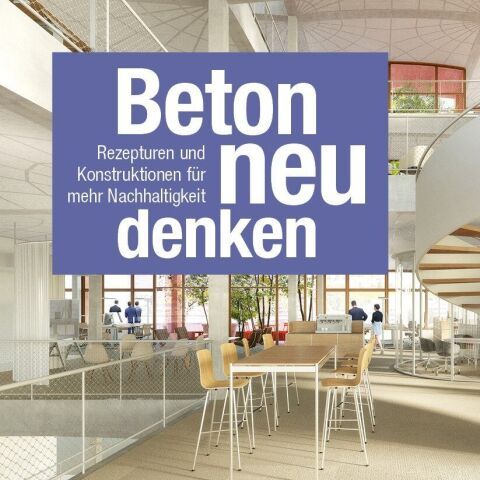Ruhe statt Stadt?
Dank für die inhaltliche Begleitung an Thomas Gastberger, Deborah Fehlmann, Andreas Sonderegger, Caspar Schärer.
Immer häufiger bodigen Gerichte derzeit Wohnbauprojekte. Sie begründen dies damit, dass Regeln zum Lärmschutz nicht eingehalten werden. Niemand bestreitet, deren Bedeutung. Wenn aber Gesetze die Verdichtung nach innen blockieren, dann gehören sie revidiert. Die Architekt*innen haben indes bereits ihre Hausaufgaben gemacht. Zahlreiche gute Beispiele zeigen: Die Bedürfnisse nach ruhigen Wohnungen, Verdichtung sowie Urbanität müssen keine Widersprüche sein und können mit den Mitteln der Architektur gelöst – oder zumindest weitestgehend entschärft werden.
Lärm macht krank. Er führt zur vermehrten Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol und verursacht unter anderem Schlafstörungen, Bluthochdruck, Konzentrationsschwierigkeiten und gar Diabetes. Dem will der Gesetzesgeber mit Regeln entgegenwirken. «Umweltschutzgesetz und Lärmschutz-Verordnung (LSV) sollen die Bevölkerung vor schädlichen oder lästigen Lärmeinwirkungen schützen. Dazu hat der Bund eine Beurteilungsmethode und konkrete Belastungsgrenzwerte für die wichtigsten Lärmarten festgelegt. Sie orientieren sich am Ziel, dass die verbleibenden Immissionen die betroffenen Anwohner in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören sollen.» So umschreibt das Bundesamt für Umwelt auf seiner Homepage die bestehenden Gesetze. 1987 wurden in der Lärmschutzverordnung für Wohn- und Gewerbezonen maximale Lärmemissionen von 65 Dezibel am Tag und in der Nacht von 55 festgeschrieben.

Um das Zwicky Areal in Dübendorf rauschen Züge und Autos. Schneider Studer Primas haben dem Lärm massive Blocks, Hallen und Scheiben entgegengestemmt. Aussen Burg ist das 2016 fertiggestellte Quartier innen jedoch ein urbaner und vielfältiger Ort. ©Andrea Helbling
Der Kniff mit dem Lüftungsfenster
Entlang von Verkehrsachsen und -knotenpunkten gestaltet es sich seitdem schwierig, Wohnräume an den Vorderseiten anzuordnen, da die Lärmgrenzwerte an den Fenstern häufig überschritten würden. Daher wurde ein Ausnahme-System geläufig: Die sogenannte «Lüftungsfensterpraxis». Wenn ein Wohnraum mindestens ein Fenster zur lärmabgewandten Seite hatte, wurde dies in vielen Kantonen als ausreichend gewertet. Solche Wohnräume durften dann auch weitere (öffenbare) Fenster hin zu lärmigen Aussenräumen haben. Thomas Gastberger, seit 2007 Leiter des Bereichs Lärmbekämpfung und Vorsorge an der Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich, erklärt: «Grundsätzlich kann man die Regeln einhalten, indem man Küchen, Treppenhäuser, WCs oder Abstellräume zur Strasse hin orientiert und alle Wohn- und Schlafräume an die Rückseiten legt. Aber die klassische Orientierung der Wohnungen zur Strasse würde so zerstört.» Und zur Strasse mit Fenstern zu operieren, die man nicht öffnen kann, oder - noch schlimmer - dort wenig bis gar keine Fenster zu haben, ist für Gastberger und die Kolleg*innen in vielen anderen Kantonen keine Option.
2016 schränkte ein Bundesgerichtsentscheid die Lüftungsfensterpraxis jedoch stark ein. Die Juristen legten das Gesetz strenger aus und konstatierten: Die Grenzwerte gelten für alle Fenster von Wohn- und Schlafräumen. Doch auch in den folgenden Jahren wurde weiter mit Ausnahmebewilligungen operiert. Man teilte Räume in drei Gruppen ein: rot = Lärm über dem Grenzwert; gelb = beim Lüftungsfenster wird der Höchstwert unterschritten; grün = alle Fenster sind schalltechnisch im gesetzlich vorgeschriebenen Bereich. Für die roten Zimmer war eine Begründung nötig. Viele Kantone liessen sich aber einfach überzeugen; die Begründung war nur eine Formalie.
Im Dezember 2021 wurde dann am Bundesgericht erneut ein einschneidendes Urteil gefällt: Es hob die Baubewilligung für die Überbauung «Im Bürgli» der Swisscanto Anlagestiftung an der Bederstrasse in Zürich-Enge mit 124 geplanten Wohnungen auf. Dabei macht der Entwurf von Graber Pulver Architekten doch eigentlich alles richtig: Die gezackte Fassade würde den Lärm streuen, Wohnungen wären durchgesteckt und möglichst viele Zimmer lärmabgewandt orientiert. Auch private Aussenräume sollte es auf der lärmabgewandten Seite geben. Dennoch befand das Gericht, nicht alle Alternativen sein geprüft und die Ausnahmebewilligung sei vorschnell erteilt worden.
Will heissen: Ausnahmebewilligungen könnten durchaus noch immer erteilt werden, aber die Begründungen müssen zukünftig sorgfältiger formuliert werden. Derzeit herrscht Verwirrung, wie argumentiert werden muss, damit sie bei etwaigen Rekursen vor den Gerichten standhalten würden. Die Rechtsunsicherheit führt zur Verlangsamung der Prozesse, macht das Bauen teurer und lässt einige Investoren gar komplett vor Projekten an lärmbelasteten Lagen zurückschrecken. Damit solche Bauvorhaben zukünftig vor Gericht eine Chance haben, empfiehlt die Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich, schon mit dem Baugesuch einen Nachweis einzureichen und gibt auf bauen-im-laerm.ch Empfehlungen für den Entwurf.
Die Liste der von Gerichten gebodigten Projekte im Kanton Zürich wird indes immer länger: Die Brunaupark-Überbauung entworfen von Adrian Streich Architekten mit 500 Wohnungen, ein Projekt der Baugenossenschaft Oberstrass an der Winterthurerstrasse in Zürich aus der Feder des Ateliers Abraha Achermann mit 134 Wohnungen und die Überbauung Ifang-Park in Schwerzenbach mit 128 Wohnungen wurden beispielsweise in den letzten Monaten zum Stillstand gebracht oder müssen umgeplant werden.
Ein besonders tragisches Detail: Die rekurrierenden Personen wohnen meist in der Nachbarschaft der geplanten Bauten. Deren Motivation ist in den seltensten Fällen die Sorge um die Gesundheit der künftigen Bewohner*innen. Ihnen geht es oft darum, ihre Aussicht unverbaut zu halten. Oder sie versuchen mitunter gar Geld zu erpressen. Es wurden Summen bis in Millionenhöhe für den Rückzug von Rekursen gefordert und geboten.
Vorstoss aus dem Parlament
In Fachkreisen sind sich alle einig: Um nach innen verdichten zu können, muss das Bauen auch an lärmbelasteten Stellen weiterhin möglich sein. Die Frage ist nur, wie es gesetzlich neu zu regeln ist. Welche Standards sollen festgelegt und wie die Qualitäten sichergestellt werden? Der GLP-Nationalrat und Jurist Beat Flach brachte 2017 im Bundesparlament eine Motion ein, die forderte, die «Siedlungsentwicklung nach innen nicht durch unflexible Lärmmessmethoden (zu) behindern». Damit kam der Vorstoss letztlich aus Fachkreisen, denn Flach ist Jurist beim Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein SIA. Er schlug vor, die Lüftungsfensterpraxis, also die Messung an einem lärmabgewandten Fenster zu legalisieren. Der Bundesrat lehnte die Motion ab. Doch der Nationalrat und die Umweltkommission des Ständerats erkannten die Dringlichkeit. Das Thema wurde an das Bundesamt für Umwelt (BAFU) delegiert. Das Departement hat daraufhin einen Gesetzesentwurf erarbeitet und ihn bis Ende letzten Jahres in die Vernehmlassung gegeben. Alle waren eingeladen, Stellung zu nehmen. Nun geht der angepasste Vorschlag zurück ins Parlament.
Für eine Lärmbaukultur
BSA, SIA, der Cercle Bruit (Vereinigung der kantonalen Lärmschutzfachleute) und die KZPV (Konferenz der Zürcher Planerverbände) haben sich im Rahmen der Vernehmlassung eingebracht. Sie sind sich einig, dass die Lüftungsfensterpraxis durch das Gesetz legalisiert werden sollte. Das sehen Lärmschutzorganisationen wie die Lärmliga jedoch anders und lehnen solche «Lockerungen» weiterhin strikt ab.
Der BSA hat indes verschiedene Ergänzungen vorgeschlagen. Der Architekt*innenverband möchte gerne ebenfalls im Gesetzt festhalten, dass jede Wohnung mindestens ein ruhiges Zimmer haben muss und einen ruhigen privaten Aussenraum. Bei diesem wertet er Ruhe höher als die Sonneneinstrahlung. Die Debatte um qualitatives Wohnen – so ihre Argumentation – soll sich nicht bloss um Geräuschpegel drehen.
Entscheidung im Parlament
Die gesetzliche Verankerung der Lüftungsfensterpraxis steht noch auf wackligen Füssen. Wahrscheinlicher ist, dass im Gesetz ein Katalog von Ausnahmeregeln verankert wird. Dafür werden derzeit die Kriterien definiert.
SVP und FDP sind für die Gesetzesänderungen offen, da die Immobilien-Firmen und Investoren traditionell ihre Klientel sind und sie ihnen möglichst einfache Rahmenbedingungen schaffen wollen. Paradoxerweise stehen dafür linke Parteien auf der Bremse. Das irritiert, würde man doch erwarten, dass sie die innerstädtische Verdichtung zugunsten von mehr bezahlbarem Wohnraum vorantreiben wollen. Man munkelt, dies seien taktische Manöver, um Tempo 30 in den Innenstädten zu erzwingen. Ihre Argumentation, der motorisierte Verkehr sei die Ursache des Problems und der Hebel daher dort anzusetzen, ist faktisch richtig. Andere denken, ein Umstieg auf Elektromobilität sei der beste Ansatz, um den Verkehrslärm zu verringern. Aber auch an stark befahrenen Lagen wird dies nicht zu Emissionen unter den gewünschten Grenzwerten führen, da zwar die Motoren-, nicht aber die Rollgeräusche wegfielen. Um diese zu reduzieren, gibt es noch die Möglichkeit, spezielle Fahrbahnbeläge aufzubringen, die den Lärm um bis zu drei Dezibel reduzieren. Sie sind jedoch teuer und weniger haltbar. Es macht daher mehr Sinn, eine hybride Strategie zu verfolgen, um den Knoten zu entflechten: Lösungen seitens der Architektur und zur Reduktion oder Verlangsamung des Verkehrs auf den Strassen müssen parallel vorangetrieben werden.
Geräuschkulissen entwerfen
Schutz vor Lärm ist wichtig. Doch im Angesicht von Klimakrise und Artensterben gewinnen andere Probleme an Gewicht. Hitzeinseln müssen vermieden werden. Flächen sollten entsiegelt werden, damit mehr Wasser versickern kann und die Artenvielfalt muss aktiv gefördert werden. Der Lärmschutz darf sich über diese Themen nicht hinwegsetzen. Mit Kreativität lassen sie sich im Idealfall verbinden. Offenporige und vielfältige Oberflächen sowie begrünte Fassaden und Dächer könnten sowohl zu einer angenehmeren Geräuschkulisse beitragen, als auch die Artenvielfalt fördern. «Lärm ist nicht gleich Lärm», resümiert Thomas Gastberger, «wenn der Kiesboden knirscht, die Vögel zwitschern oder ein Brunnen plätschert, dann empfinden wir das als angenehm. Wir müssen in Zukunft Klangräume gestalten, statt bloss auf Dezibelwerte zu schauen.»

Beim 2017 fertig gestellten Wohnhaus in der Allenmoosstrasse in Zürich haben Michael Meier und Marius Hug Architekten das Potenzial von Erkern für den Lärmschutz ausgespielt. In den Zimmer an den Gebäudeecken ist es möglich, über die Fenster zu lüften, obwohl die Strassen davor laut sind. ©Roman Keller
Mitreden!
Weil das Lärmschutzgesetz nach der Vernehmlassung bald wieder im Bundesparlament verhandelt wird, und dort wie beschrieben noch unklar ist, ob die Revision eine Mehrheit findet, ist es jetzt wichtig, eine möglichst breite Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Die Revision ist von zentraler Bedeutung, weil es um nichts Geringeres geht als um die Frage, wie die Fassaden in den Innenstädte und Agglomerationen zukünftig gestaltet sein werden.
Die Redaktion plädiert ebenfalls für einen praxisorientierten Zugang. Dazu zeigen wir im Architekturteil dieses Mags vier gute Beispiele, die darlegen, wie es mit den Mitteln der Architektur möglich ist, an lärmigen Verkehrsachsen Wohnungen und Büros mit hoher Qualität zu erstellen. Um ein nützliches Gesetzt zu formulieren, darf künftig nicht nur rein von den Lärmpegeln her gedacht werden, sondern es müssen von den besten architektonischen Lösungen kommend neue, praxisbezogene Regeln erstellt werden. Und diese müssen so einheitlich und verbindlich sein, dass die vielen unterschiedlichen Praktiken in den Kantonen zugunsten einer einheitlichen Lösung verschwinden.
Am 16. Juni werden wir dieses Thema im Rahmen eines Arc Afterworks mit fünf Expert*innen vertieft diskutieren. Thomas Gastberger wird zur Einführung die Situation rund um den Lärmschutz darstellen - vom bestehenden Lärmschutzgesetz, über die bisherige Praxis bis zum Stand der Revision des USGs. Danach schildern die Architekten Urs Primas, Alain Roserens und Piet Eckert ihre Erfahrungen und zeigen Projekte, bei denen sie die Lärmbelastung als Sprungbrett für prägnante Entwürfe und ungewöhnliche Grundrisse aktiviert haben. Moderiert wird die anschliessende, etwa halbstündige Gesprächsrunde von Deborah Fehlmann, die am Institut Konstruktives Entwerfen der ZHAW zum Thema «Bauen trotz Lärm» forscht. Ziel wird es sein, konkrete Ideen zur Gestaltung einer neuen Lärmbaukultur zu entwickeln. Melden Sie sich jetzt auf baudokumentation.ch an; seien Sie dabei und diskutieren Sie mit!