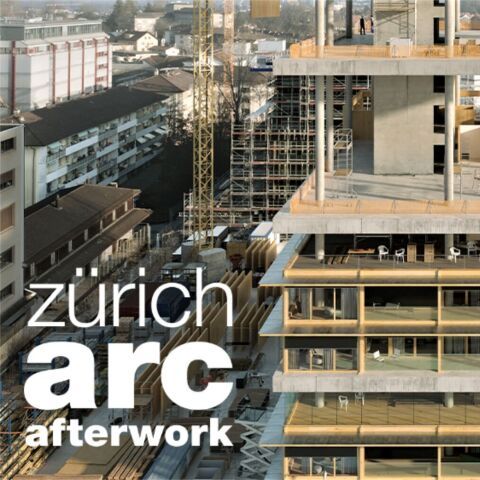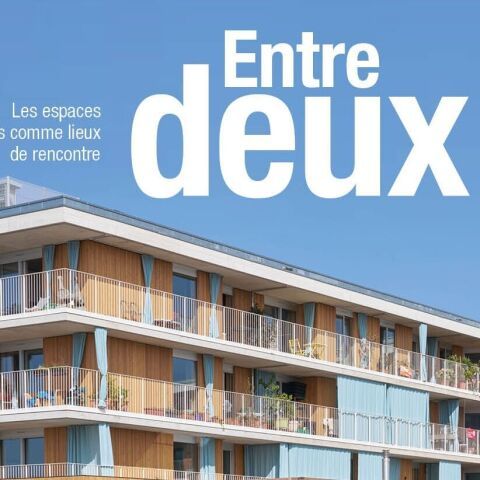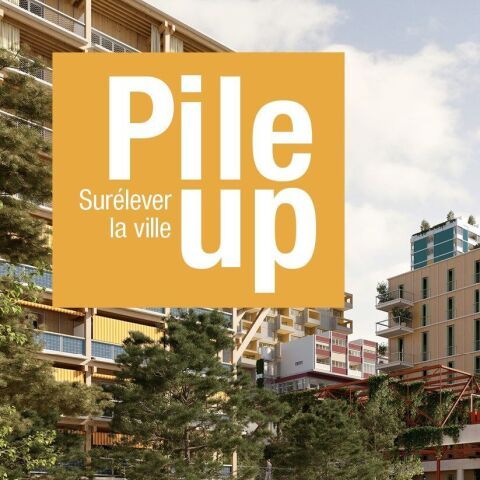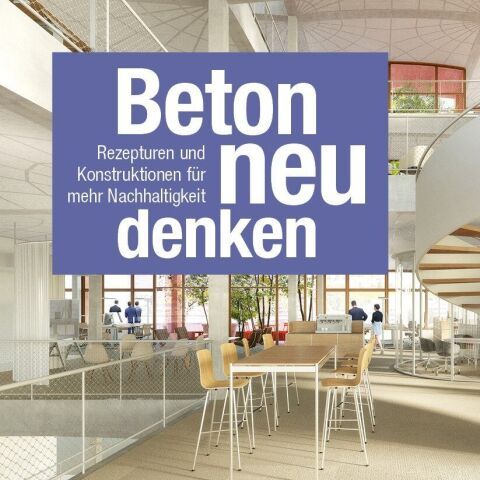Wachgeküsst – ein Vortragsabend zu Umbauten der 1960er- und 1970er-Jahre
Auffällig oft wurden der Redaktion in den letzten Monaten Dossiers über Umbauten und Sanierungen von Gebäuden aus der Zeit der Nachkriegsmoderne und speziell der 1970er-Jahre zugesandt. Das lässt aufhorchen, schien doch in der Schweiz für einige Jahre Abbrechen und Ersetzen - meist begründet mit energetischen Defiziten und dem Wunsch nach mehr Dichte - das Mittel der Wahl zu sein. Häufig sind es jedoch vor allem ästhetische Präferenzen beziehungsweise Aversionen, welche die Entscheidungen zum Abreissen befeuern. Denn vielen Laien gelten die 1970er-Jahre als «Epoche des schlechten Geschmacks». Und auch in der Architekturgeschichte der Schweiz klafft an dieser Stelle ein eigenwilliges schwarzes Loch: Die meisten Narrationen springen von der klassischen Moderne unmittelbar zum Minimalismus der 1990er-Jahre. Dabei hat diese Dekade - auch in der Schweiz - wichtige Protagonisten und wegweisende Arbeiten hervorgebracht: Walter Maria Förderer, Esther und Rudolf Guyer und Max Schlup sind nur einige der zahlreichen Architekt*innen dieser Zeit, die darauf warten, wiederentdeckt zu werden.
Aufbruch …
Im Rückblick auf die 1970er-Jahre werden vor allem Grosssiedlungen als ihr bauliches Erbe wahrgenommen. Diese wurden schon zu ihrer Entstehungszeit häufig als monoton und einfallslos kritisiert. Grosswohnbauten boten zwar den dringend benötigten günstigen Raum für die Boomer; oft fehlten ihnen aber öffentliche Infrastrukturen. Kritiker wie Rolf Keller gingen gar so weit, das gesamte Baugeschehen der Zeit als «Umweltzerstörung» zu geisseln - dies auch wegen der Fixierung auf den privaten Automobilverkehr und den entfesselten Kräften der Bauspekulation.Dabei waren die 1960er- und 1970er-Jahre eine Zeitspanne, die geprägt war von wirtschaftlichen Aufschwung und schnellem Wachstum, in der eine allgemeine Aufbruchsstimmung herrschte. Es war eine Phase der Umbrüche, Öffnungen und Experimente - kulturell ganz allgemein, aber auch in Bezug auf die Architektur im Besonderen. Werte, Normen und Lebensmodelle wandelten sich. Neue Formen des Zusammenlebens wurden möglich, ausprobiert und ihnen mitunter auch architektonisch Raum gegeben. Die Raumfahrt beflügelte und inspirierte auch das Bauen. Die Architektur wurde heroischer, poröser und optimistischer. Mit grosser Geschwindigkeit wurden Wohnungen, Schulen, Universitäten, Theater, Museen und Infrastrukturbauten errichtet. Oft griffen die Bauten dieser Zeit in die Landschaft aus, motivierten die Nutzer*innen in ihrer Freizeit nicht mehr in der bürgerlichen Stube zu hocken, sondern stattdessen hinauszugehen und sich neue Horizonte zu erschliessen. Viele Schulen der Zeit, die als lose Gruppe von Pavillons in die Topografie hineinkomponiert wurden, zeugen noch heute von diesen Konzepten. Die Werte des Wohlfahrtsstaates und das Ideal der Chancengleichheit wurden durch üppige öffentliche Räume wie Plätze, breite Freitreppenanlagen oder künstliche Wasserlandschaften ausgedrückt.
...und Krise
Es sind vor allem kulturelle Setzungen, die man aus der Architektur einer Epoche - bewusst oder unterbewusst - herausliest und wertet. Und genau das mag die ambivalenten - meist negativen -Bewertungen der Artefakte aus dieser Zeit im Rückblick begünstigt haben. Denn die Ölkrisen von 1973 und 1979 führten zu ökonomischen und kulturellen Depressionen. Der Club of Rome prognostizierte 1972 «die Grenzen des Wachstums» und es breitete sich die Angst aus, dass die globalen Rohstoff- und Wohlstandsquellen versiegen könnten. Terrorismus, der Kalte Krieg und eine wachsende Arbeitslosigkeit führten - vor allem in Europa - zu einem konservativen Backswing. Was zuvor als Aufbruch schien, wirkte in diesem neuen Licht als Krise, als Symptome eines kulturellen Verfalls.
History Repeating
Rohstoffknappheit, wachsende soziale Ungleichheit und apokalyptische Umweltkrisen: Diese Bedrohungen kommen uns derzeit unangenehm bekannt vor. Allem voran die Erderwärmung hat die kritischen Themen der 1970er-Jahre erneut aufs Tapet katapultiert. Um den Treibhauseffekt - verursacht durch eine steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre und in den Meeren - zu verlangsamen, müssen die Emissionen möglichst schnell und drastisch reduziert werden. Dazu hat sich auch die Schweiz verpflichtet. Bis zum Jahr 2050 soll sie «netto null» bezüglich ihrer Kohlendioxid-Emissionen sein - so hat es der Bundesrat im August 2019 beschlossen. Doch wie soll es gelingen, binnen drei Jahrzehnten das System so umzugestalten, dass nicht mehr CO2 ausgestossen wird, als es die natürlichen und technischen Speicher aufnehmen können? Das Heizen und Kühlen von Gebäuden ist derzeit für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Die klimatische Ertüchtigung des Gebäudeparks und das Einbringen möglichst CO2-neutraler Energiegewinnungen ist daher noch immer eine wichtige Aufgabe. Aber auch das Bauen selber muss in den Blick genommen werden. Weil Abriss und Neubau in der Schweiz derzeit 85 Prozent des Abfalls verursachen und für 20 Prozent aller Kohlendioxidemissionen verantwortlich ist, ist klar, dass auch hier ein grosser Hebel und Handlungsbedarf besteht. Jährlich werden in der Schweiz 4000 Bauten abgerissen. Um dort auch künftig drastisch einzusparen, muss - wenn immer möglich - der Bestand ertüchtigt werden, statt neuzubauen. Und Re-Use muss das Ersatzneubauen und auch das energieaufwendige Recyceln ersetzen.
Learning from the 70s
Die Bauten der 1970er-Jahre sind in dieser Hinsicht dreifach interessant: Zum einen schlicht als Baumaterialspeicher, mit dem man weiterarbeiten kann - beziehungsweise muss. Zum anderen, da bei steigenden Temperaturen die Verzahnung des Gebauten mit der Landschaft wieder ein grösseres Thema wird. Künftig wird die Frage, wie wir Gebäude und Städte im Sommer kühlen, beziehungsweise ein zu starkes Aufheizen vermeiden können, an Bedeutung gewinnen. Und drittens könnte es sich lohnen, zu reflektieren, wie die Architekt*innen auf die Krisen vor 50 Jahren reagiert haben. Macht man eine Auslegeordnung der jüngsten Renovationen und Umbauten von Gebäuden aus den 1970er-Jahren, dann zeigen sich bemerkenswerte architektonische Qualitäten, die für die aktuelle Debatte von Wert sein könnten - allem voran bezogen auf das beschriebene notwendige Verweben von Architektur und Landschaft, aber auch in Bezug auf kompakte, clevere Grundrisse und Typologien.
Schattenseiten
Doch müssen im Rahmen einer Reflexion der Architekturen der 1970er auch problematische konstruktive Aspekte besprochen werden: Gebäude aus dieser Zeit weisen typische Mängel auf. Konstruktiv bedingte Schäden und Materialversagen zwingen zum Handeln. Mitunter müssen gesundheitsschädliche Substanzen entfernt werden. Häufig sind feuchte Keller, Aussenwände mit schlechten Dämmwerten, einfachverglaste Fenster, minimaler konstruktiver Schallschutz, Wärmebrücken bei auskragenden Bauteilen, Abplatzungen bei Sichtbeton und weitere Probleme zu lösen.
Ins Detail gehen
Um den Potenzialen und Problemen von Bauten der 1970er-Jahre nachzuspüren, wurden zum nächsten Arc Afterwork in Basel zehn Architekt*innen eingeladen, Umbauprojekte von Gebäuden aus den 1970er-Jahren vorzustellen. Sie stellen sowohl Probleme als auch Potenziale dar. Der beschriebene historische, konstruktive und politische Hintergrund soll der Nährboden sein, auf dem eine Neubewertung stattfinden kann. Gezeigt werden einige Schul- und Wohnbauten, aber auch Umnutzungen von Infrastrukturgebäuden.Folgen Sie dem Link mittels QR-Code zum Online-Anmeldeformular und sichern Sie sich Ihr gratis Ticket für den Event in der Halle 7. Los geht es um 17.30 Uhr mit einem Apéro. Die Kurzvorträge dauern bis 20 Uhr. Danach gibt es ein Flying Dinner, bei dem Sie mit Kolleg*innen und den Industriepartnern des Events weiter über das Thema Umbauen beraten können.
Wir freuen uns auf Sie!